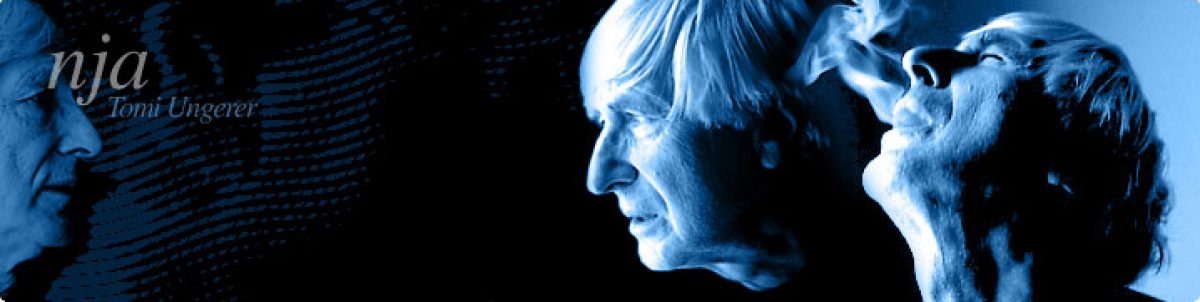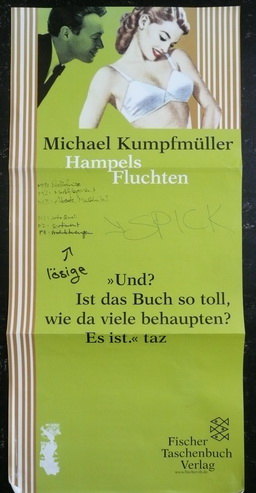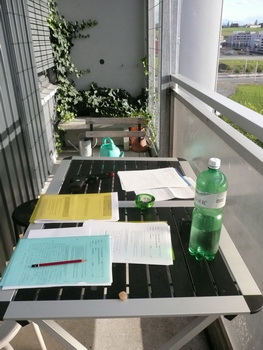Die letzte Ausgabe unserer Schulzeitschrift, der Pegasus Nr. 97, ist versandt und online. Sehr ans Herz legen möchte ich Michael Krügers Essay (S. 11).
Wir wissen (noch) nicht, wie eine literarische Kultur im Zeitalter der elektronischen Verfügbarkeit aussehen könnte, aber wir können ahnen, dass sie sich von unserer prinzipiell unterscheidet. Ob es gelingt, die juristischen und organisatorischen Fragen zu lösen, die eine «freie», demokratische Verbreitung von geistigem Eigentum gewährleisten, ist mehr als offen. Viel wichtiger aber ist die Frage, welches Menschenbild im Verlauf der rasanten Entwicklung der Technik aus dem Netz aufsteigt. Ob wir uns in ihm noch erkennen werden, bleibt abzuwarten. Es bleibt unheimlich und macht nicht froh, dass der Mensch auf vielen Gebieten einer Entwicklung hinterherläuft, die immer schneller ist als er und ihm die Bedingungen diktiert, unter denen er leben soll.
Sehr schwer ums Herz ist mir, weil wir einen Lernenden verloren haben (S. 23). Denn auch wenn sie es nicht immer glauben, wir Lehrer wünschen uns für unsere Schüler hauptsächlich eines: Zukunft.