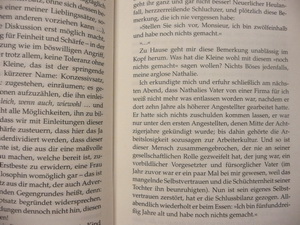
Daniel Pennac
Schulkummer
Kiepenheuer & Witsch 2009
ISBN 978-3-462-04072-2
Originaltitel: Chagrin d’école
Zuerst muss man den «Cancre» kennen lernen. Pennacs Übersetzerin Eveline Passet hat ihn völlig zu Recht beibehalten, denn der Begriff «Cancre» ist nicht ins Deutsche übertragbar. Im Wörterbuch steht zwar «Krebs, Krabbe, bösartige Geschwulst, schlechter Schüler.» Das französische Wort bezeichnet alles zusammen und vor allem nicht nur den «schlechten Schüler», sondern den Schmerz, den schlechte Schüler erleben. Und genau darum geht es Pennac, dem Schulversager.
Eine leicht verkäufliche Lektüre, die viele Leser mögen: ideenreich, einfühlsam und mit einem Appell versehen. Letzteres aber nur nebenbei, wer nicht will, kann den bildungspolitischen Aspekt auch überlesen und sich hier ganz und gar der eigenen oder Pennacs Schulbiografie widmen. Der Autor blickt nämlich auf eine besonders lange Schulzeit zurück, denn er musste manche Klasse wiederholen und ist erst nach vielen gescheiterten Versuchen, Abitur und Studium zu überstehen, Lehrer geworden.
Die Wechselwirkung der Schüler- und Lehrerperspektive macht dieses Buch besonders. Bei Pennacs Biografie sind beide Sichtweisen gegeben und das ist sein Vorteil. (Auch Guggenbühl, Largo oder Jegge sind in Sachen «Schulkummer» stark, aber sie scheinen selber sehr effizient und kennen den Schulversager meines Wissens nur als Klienten.) Nun ist die Fähigkeit, sich ineinander hineinzuversetzen für Lernende und Lehrende sehr praktisch, beide Parteien können bei Pennac viel abgucken. Seine Strategie als Schulversager waren Ausflüchte und Auswendiglernen, sein Gefühl war, eine Null zu sein. Er war stets überzeugt, «es» sowieso nicht zu begreifen. Als Lehrer schaute er «es» mit seinen Schülern an. Was verbirgt sich dahinter? Pennac analysierte die Ausreden grammatikalisch und liess seine Cancres den Satzbau ihrer Antworten sezieren. Natürlich gab es in Pennacs Klassen auch «Leckerbissen», wie er seine guten Schüler insgeheim nennt. Pennac unterrichtete Muttersprache und musste seine Aufgabenstellung im Einwanderungsland Frankreich auf unterschiedliche Niveaus ausrichten. Er machte deswegen gerne Experimente.
Einmal wollte er von seinen Gymnasiasten wissen, wie sie sich die Instanz vorstellten, die die Abituraufgaben produziert. Im entsprechenden Aufsatz beschrieben alle eine einzelne allwissende, ziemlich gottähnliche Figur. Also nahm Pennac mit der Klasse
alte Abituraufgaben auseinander und erteilte danach den (benoteten) Auftrag, eigene Aufgaben zu erstellen. Sofort bildeten sich Arbeitsgruppen und es wurde allen schnell bewusst, dass niemand allein sämtliche Aufgaben verfassen und über ganz Frankreich verstreuen kann. Im nächsten Test stellte Pennac die von den Gymnasiasten selber gemachten Aufgaben und erhielt – wen wundert’s – fulminante Resultate.
Hier, etwas über der Mitte des Buches, beginnt der Autor erneut ein Gespräch mit seinem inneren Cancre, der ihn dazu provoziert, auch über Misserfolge als Lehrer zu sprechen. So erzählt er von den Cancres in seinem Unterricht, die trotz aller Bemühungen
durch die Netzte gefallen sind, die, die sich seiner Originalität oder seinem Anspruch an Höflichkeit verweigert haben und die, die er völlig aus den Augen verloren hatte. Da zeigt sich der versierte Schriftsteller: Denn ohne diese Wende hätte man die Biografie
vom schlechten Schüler, der zum perfekten Lehrer wurde, an dieser Stelle mit einem leisen Seufzer zur Seite gelegt, um sich Glaubwürdigerem zuzuwenden.
Die Retter seiner Schulzeit seien die Lehrer gewesen, die rein auswendig gelernte und absurde Antworten nicht tolerierten. Die, die zurück gefragt und die Methode geändert hätten, die, die flexibel genug gewesen wären, anstatt eines Aufsatzes als
Wochenarbeit, dem Legastheniker Pennac einen täglichen Fortsetzungsroman in Auftrag zu geben. Und natürlich die, die sich für seine Lektüre interessiert hätten. Denn in Pennacs Jugend war Lesen nicht «die absurde Meisterleistung, die es heute ist.
Es galt als Zeitverschwendung, die vom Lernen abhält und so war uns während des Silentiums das Lesen von Romanen verboten.» Sich nach der Lektüre eines Lernenden zu erkundigen, brauchte damals vielleicht ähnlich viel, wie sich für die Musik heutiger Lernender zu interessieren. Musikhören ist nach Ansicht vieler Lehrpersonen eher mühsame Ablenkung denn kulturelle Leistung.
Es ist schön zu lesen, wie ein Cancre den Weg schwimmend, krabbelnd, grabend findet und wie er immer wieder Begegnungen hat, die seinen alten Kummer in ein neues Interesse verwandeln, das er als Lehrer seinen Cancres und Leckerbissen weiter gibt. Dieses Buch sei allen empfohlen, die etwas mit Schule zu tun haben, besonders denen, die Schule nicht zu mögen glauben.
(Für Pegasus-Leserinnen und -Leser: Ja, das ist die Buchbesprechung aus der neuen Nummer.)
Zum Inhalt springen

hier liegt es.
ich lese sporadisch.
wieder sagt es jemand: liebe und akzeptanz: das nötigste für die lebensschule! …es gibt keinen hoffnungslosen fall…und bewirkt hat es schon, dies buch, dass ich in der schule wieder mehr lächle- ist doch was, oder?
Hui, wenn das Lächeln zurückkehrt, ist das schon mehr als die halbe Miete. Aus der Verkaufsforschung weiss man, dass Blickkontakt von allen am ersten gewünscht wird („ich will angeschaut werden!“). Und – ausser in Reklamations-Situationen – gepaart mit einem Lächeln. Und Unterrichten hat meines Erachtens sehr viel mit Verkauf zu tun.
Wieder eine sehr interessante Pegasus-Nummer! Herzlichen Dank und lieber Gruss.