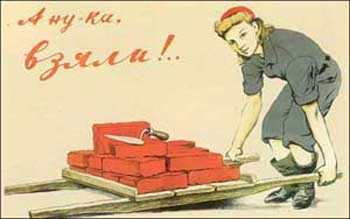Neulich hat mich jemand gefragt, wer Françoise Alsaker sei und ich habe versprochen, darüber etwas zu bloggen. Am 28. April 2004 hielt sie ein Referat, das meine Schwester besucht und bei dem sie für mich Notizen gemacht hat. Herzlichen Dank!
Hier die aktuellen Aussagen zusammengefasst:
Mobbing ist ein Muster.
Mobbing ist kein Konflikt.
Konfliktlösungsstrategien taugen nicht.
Es gibt keinen Grund zum Streiten, also kann es auch keine Einigung geben.
Gegenüberstellungen von Täter und Opfer bringen nichts.
Es kann jedes Kind treffen. Kinder, die leicht und oft „Nein!“ sagen und sich weniger kooperativ verhalten sind seltener Opfer.
Gegen Mobbing kann man sich nicht wehren, das Ungleichgewicht ist zu stark, der Ratschlag „wehr dich!“ ist vertane Zeit.
Mobberziel und –Befriedigung ist die Täuschung der Erwachsenen.
Mobbing in indirekten Formen wie subtile Beleidigungen, Körpersprache, Blicke, Gerüchte, Intonation ist für Lehrpersonen schwierig zu erkennen und zu ahnden. Kein Weg führt an Beobachtungen, Dokumentation und Reaktion (auch auf Kleinigkeiten) vorbei.
Erfolgreiches Mobbing bringt den Tätern Macht, Action, Gruppengefühl, Bestätigung und dadurch Vorteile. Sie werden es wieder tun.
Die schlimmste Folge von Mobbing ist der Suizid, was sowohl in den USA wie auch in Europa vorkommt.
Ich habe mich in die Thematik aufgrund der ersten Studien eingelesen. Ende der Neunzigerjahre haben Olweus und Limber festgestellt, dass das Problem eine neue Dimension auf der Palette der Gewalttätigkeiten einnimmt. Auch sie haben von Anfang an körperliche, psychologische wie verbale Attacken unterschieden.
Marr und Field haben sich ebenfalls 1999 mit dem Thema wer Opfer und wer Täter sei befasst. Aus meiner Sicht und leider eigener leidvoller Erfahrung muss ich sagen, dass ihre Täterbeschreibung noch heute sehr gut passt:
Bullies are, in a word, cowards. They project their own shortcomings and wrongdoings onto targets who are physically inferior to them. They control their targets with threats of violence, which are almost always carried through, sometimes with fatal consequences. And when bullies are called on their actions, they often say they were “provoked” by their targets.
Marrs und Fields Opferprofil hingegen hat inzwischen zahlreiche Ergänzungen erfahren:
Only the best are bullied. Individuals who are targeted are typically sensitive, respectful, honest, creative, and of high emotional intelligence. Targets typically have a strong sense of fair play and high integrity with a low occurrence of violence.
Was Alsaker heute feststellt, liessen schon Marr und Field anklingen:
Because bullies are driven by jealously and envy, they have an obsessive compulsion to torment and destroy those who are better than they are, which is most of the population.
[Quelle: Bullies … Whom are they hurting?]
Und die Eltern? Immer in Angst und immer mit dem Ratgeber im Hinter- und Vorderkopf:
Fragen: wer, wo, wann?
Fragen: wie bist du da rausgekommen?
Sagen: es ist normal, dass es dir beschissen geht.
Information und Kommunikation mit Fachstellen und Fachpersonen.
Keine Konfrontation mit Tätern und deren Eltern.
Anzeige.
Aber nicht nur Eltern sind Faktoren, sondern auch die Schule, gerade die Grundschule. Ken Rigby schreibt zu dem Schulfaktor:
The social context and supervision at school have been shown to play a major part in the frequency and severity of bullying problems. While teachers and administrators do not have control over individual and family factors which produce children who are inclined to bully, bullying problems can be greatly reduced in severity by appropriate supervision, intervention and climate in a school.
Jeden Tag zweifle ich, dass die Schule weiss, dass sie ein entscheidender Faktor ist. Und zugleich muss ich fragen, wer ist sie denn, „die Schule“? Wohl nicht nur der Gang, die Garderobe, der Wasserhahn und der neue Turnhalltenbelag. Die Schule sind wir, Lehrerinnen und Lehrer. Es ist an uns. Und gerade Alsaker hat Tipps, von denen mir keine Lehrperson sagen kann, sie hätte nicht die Kapazitäten diese umzusetzen.
Literatur und Empfehlungen von F. Alsaker:
1. Quälgeister und ihre Opfer
2. Medienpaket: Mobbing ist kein Kinderspiel
3. Gruppe für Prävention