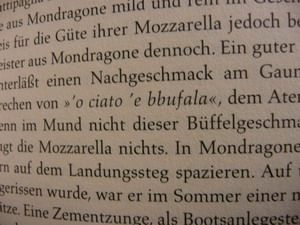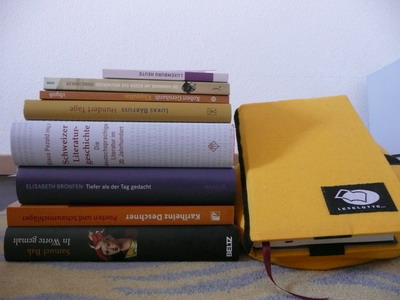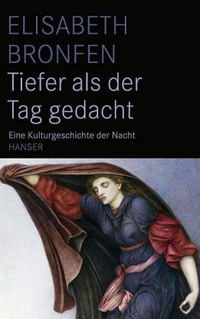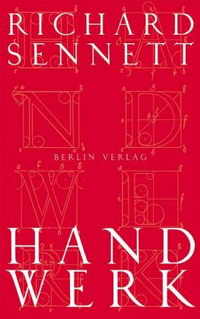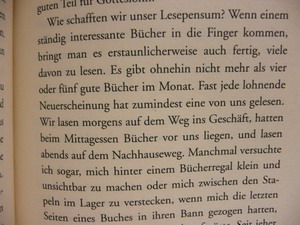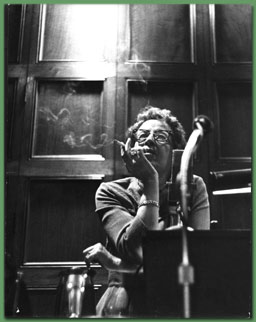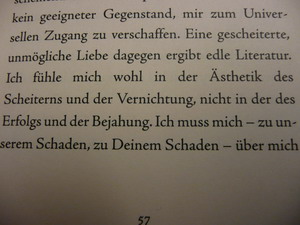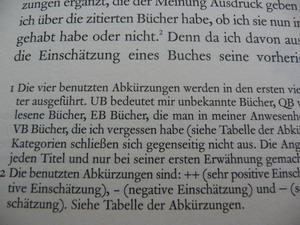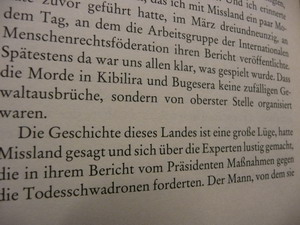
Lukas Bärfuss
Hundert Tage
Wallstein 2008
9783835302716
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, die „Hundert Tage“ gingen unter, weil der Titel das Pech hatte, gleichzeitig mit „Die Wohlgesinnten“ zu erschienen. (Natürlich freue ich mich mit dem Buchhandel über Littells grandiosen Absatz, aber ich denke dann immer an die Bücher, die durch solche Monumente ihres Rezensionsplatzes beraubt werden. Es gibt Werke, da kommt unweigerlich der Punkt, an dem Presse und Kritiker flächendeckend meinen, es sich nicht mehr leisten zu können, nichts zu meinen. Herr amore.s hat mich mit seinem frühen Hinweis auf zwei Besprechungen ein wenig beruhigt.)
Bärfuss ist in meiner Erinnerung ein eher verträumter Buchhändler meiner Generation. Doch hat er sich in den letzten Jahren zu einem hellwachen Dramatiker gemausert. Sein erster Roman (über diese Bezeichnung könnte man streiten, aber das ist sekundär) handelt von Entwicklungshilfe und Ruanda 1994, doch auch in den vorherigen Jahren, in denen sich die Katastrophe anbahnte. Mir ist diese Zeit gut in Erinnerung, ich habe damals für die Entwicklungszusammenarbeit Bücher vertrieben und hatte einige Kunden in Ruanda, Einheimische und Schweizer. Ich erkannte in Bärfuss Buch so viele und so vieles wieder, ich konnte mich völlig in die Zeit zurückversetzen und habe sicher deshalb auch einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Buch.
„Hundert Tage“ ist weit entfernt von der Katastrophenbelletristik, wie sie häufig in den ersten Jahren nach einem Schreckensereignis entsteht. Bärfuss‘ Geschichte um den Entwicklungshelfer David Hohl ist im Gegenteil ein schöner Beleg dafür, wovon literarische Verarbeitung lebt: von losen Enden, die nur die Zeit und eigenständige Autoren zusammenbringen können. Es gelingt Bärfuss auf wenigen Seiten Fakten darzulegen, für die ein Sachbuch schnell einmal ein Mehrfaches braucht; dazwischen liest man von einem schweizerischen Gefühl, welches sachlich schwierig abzuhandeln und beinahe peinlich wäre: Diese vertraute Helfersehnsucht. Das Bedürfnis ein fernes Land zu besiedeln, indem wir es aufforsten, jeden Hügel mit eine Projekt besetzen und keine Schule unreformiert lassen. Die Freude an Pünktlichkeit und Sauberkeit, besonders im Vergleich zu den anderen afrikanischen Entwicklungsländern. Und die zielsicher verpassten Chancen, sich der Tabus bewusst zu werden:
Ob Kurze oder Lange: Sie sprachen alle dieselbe Sprache und wir hatten keine Ahnung, wie wir sie zweifelsfrei unterscheiden sollten. Es gab natürlich lange Lange, solche, die hoch gewachsen waren, eine vergleichsweise helle Haut und eine schlanke Nase hatten; und daneben gab es kurze Kurze, dunkler als die Langen, gedrungener, mit breiten Nasen und üppigen Lippen, und wenn es nur solche Typen gegeben hätte, wäre die Sache einfach gewesen. Lange, die gross gewachsen waren und eine dunkle Haut besassen, helle Kurze mit feinen Nasen, dunkle Lange mit dicken Lippen – jede möglich Kombination, und in neun von zehn Fällen war nicht auszumachen, wer ein Kurzer und wer ein Lager war. Das galt jedoch nur für uns Europäer, die Kurzen wussten auf den ersten Blick, wer ein Kurzer war und dazugehörte, und dasselbe galt für die Langen. Wir hatten keine Ahnung, woran sie sich erkannten, ob sie ein für uns unsichtbares Zeichen auf der Stirn trugen, ob sie auf eine bestimmte Weise rochen. Sicher konnte man nur sein, wenn einer die Identitätskarte vorwies. Dort war das Nichtzutreffende gestrichen, als wollten die Behörden dem Bürger deutlich machen, was er war;
David Hohl erlebt den Genozid versteckt, er ist freiwillig in Ruanda geblieben. Er hofft auf Abenteuer, eine neue Herausforderung und darauf, Agathe wieder zu finden. Er hat sie vor dem Krieg kennen gelernt und von grosser Liebe kann eigentlich gar nicht die Rede sein. An einer wunderbaren Stelle im Buch will er sie mit seinem Know-how über Hülsenfrüchte beeindrucken. Er referiert darüber, dass Bohnen höchst empfindliche Gewächse seien obwohl sie einen widerstandfähigen Eindruck machten und dass der ruandische Volksmund, man erkenne jemanden an seinen Bohnen, dem schweizerischen sehr nahe komme. Doch Agathe hat kein Interesse an Landwirtschaft, wovon ihre Heimat ernährt wird, ist ihr egal, sie fühlt sich höchstens drangsaliert.
In seinen einsamen Rückblicken ringt David Hohl immer wieder um die richtige Formulierung des Verhältnisses zwischen ihm und Agathe. Das bietet einen seltsam treffenden Rahmen für diese erschütternden Monate, die uns – mich auf jeden Fall – auch hierzulande geprägt haben. In Ruanda fiel alles zusammen, worauf wir aufgebaut hatten, im Zeitraffer, gut sichtbar und brutal. Was wir Gutes hatten tun wollen, erwies sich als falsch. Trotzdem ist dieses Buch mehr als eine erneute Entzauberung unserer humanitären Tradition. Was zum Vorschein kommt, ist nicht Schlussfolgerung, nicht Schuld, sondern vielschichtiger und zeitgenössischer – viel eher eine Art Zukunft.