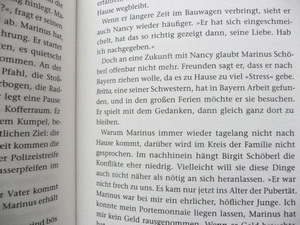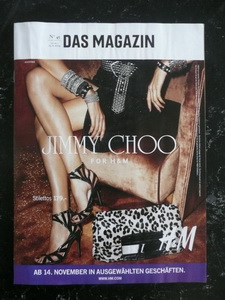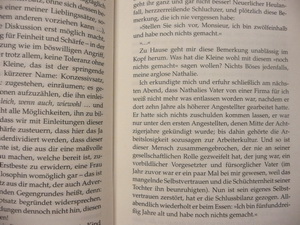Auch wenn ich ab und zu Anzeichen von Aufklärung entdecke, so erhole ich mich von den Zeichen ihres Untergangs zusehend langsamer. Zum Beispiel heute: Ich las auf der Titelseite meiner Tageszeitung, dass ein sehr verehrter Autor zu Wort komme. Ich freute mich. Zu früh.
Das samstäglich beiliegende Magazin, das mir mit Portrait angekündigt worden war, sah so aus:
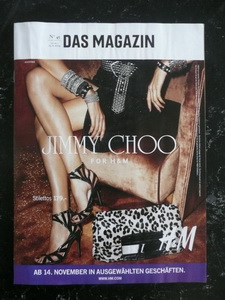
Ok, diese scheusslichen Kondomtitelblätter sind jetzt in Mode und der Presse ist die Werbeeinnahme zu gönnen. Ich beugte mich den Umständen und blätterte:

„Auschwitz war für mich ein Gewinn“ – mir blieb die Spucke weg. Auch wenn man Imre Kertész Leben und Werk nur streift, die Begründung für den Nobelbpreis googelt oder einen Klappentext liest, ist unübersehbar, dass Kertész den Überlebenden und den Schriftsteller trennt. Dort, wo er den Holocaust als Gewinn oder Momente des Glücks im Lager erwähnt, ist er Schriftsteller, Bewusstseinschaffer, einer, der er ohne Auschwitz und Buchenwald nicht geworden wäre. Klar, das lässt sich schlecht auf eine Titelseite schreiben, dann zitiert man doch lieber ganz und gar falsch.
Wer die infantilen Fragen des Journalisten erträgt und das ganze Interview liest, bemerkt den Fehler. Viel mehr aber nicht. Als ob es bei einem Gesprächspartner wie Kertész nicht zahlreiche Gelegenheiten über die Belanglosigkeit hinaus gäbe.
Die Bücher anderer Autoren über diese Zeit, interessieren Sie die?
Zum Teil. Paul Celans Todesfuge ist ausserordentlich, die wunderbaren Essays von Jean Améry, Primo Levys Roman, Tadeusz Borowski sowieso. Doch der Rest ist meistens Kitsch: Eine glückliche jüdische Familie kommt ins KZ, einige überleben, andere nicht, am Ende werden sie von der Roten Armee gerettet — solche Bücher wurden in Ungarn ohne Ende publiziert. Das Lagerleben als Story. Das geht nicht.
Da könnte man doch ganz einfach fragen: „Weshalb?“ (Und Primo Levi könnte man auch korrekt schreiben, ein Buch-Onlineshop sollte auffindbar sein.)
Aber nein. Es folgt die Frage „Was ist mit den Filmen?“ und bei der nächsten Gelgenheit, als man wieder fragen könnte, weshalb ein Zeuge wie Kertész einen Film wie „La vita et bella“ so passend findet, wird er gefragt, ob er den neuen Tarantino gesehen habe.
Wie gesagt, das war heute morgen und erholt habe ich mich davon noch immer nicht. „Dossier K.“ von Kertész gehört zu meinen zehn besten Titeln zum Thema Lesen (und Schreiben). Was mir fehlt, ist Gelassenheit zum Thema Lesen (und Schreiben).