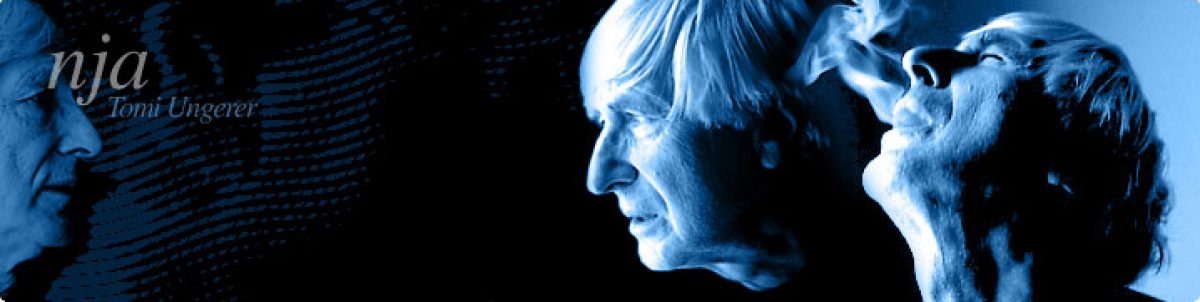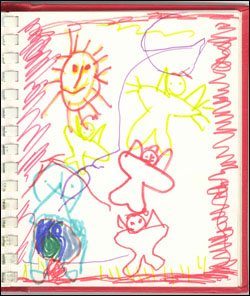Wie angekündigt, stelle ich auch mich und die Berufsschule, an der ich unterrichte, der Kritik:
Die didaktischen Grundlinien der Schule sind trasparent.
Ist nur teilweise gegeben. Die Lernziele sind klar in internen Lehrplänen festgelegt und für alle transparent, das heisst zugänglich. Die Bewertungskriterien sind unterschiedlich und doch relativ klar. Ob Auftrag und Bewertung immer übereinstimmen… daran zweifle ich und daran arbeit ich.
Alle Lehrpersonen kennen die Grundsätze der Schule und können sich mit ihren identifizieren.
Ist weitgehend gegeben. Intern kommt es natürlich oft zu Diskussionen aber gegen Aussen ist die Identifikation sehr gross. Die Unterrichtsbeurteilung durch die Lernenden ist im Vergleich mit anderen Schulen des Kantons belegt die vordersten Plätze, was für mich ein Zeichen der Einigkeit ist.
Die Infratstruktur, das Honorar, das Weiterbildungsangebot für die Lehrpersonen, die Zusammenarbeit und die Führungskultur der Schule entsprechen andragogischen (erwachsenenbildnerischen) Leitvorstellungen.
Die Infratruktur ist gut, aber die Schule ist zu klein, eine Tatsache, die man nicht einfach so ändern kann. Das Honorar ist angemessen, aber der Leistungsauftrag nimmt unangemessen zu. Die Zusammenarbeit ist sehr unterschiedlich gut, aber wenn ich auf die letzten zehn Jahre blicke, hat sie sich verbessert. Durch Qualitätssicherung haben wir Kommunikationswege, die wirklich gut und transparent sind, das dient auch der Führungskultur.
Die Übereinstimmung mit den Gesetzen, den Lehrplänen und den Ämtern wird sporadisch überprüft.
Ja, das wird regelmässig gemacht. Durch die ständigen Reformen wäre es gar nicht möglich, das unter den Teppich zu kehren.
Es werden Lehrpersonen mit viel und aktueller Berufserfahrung beschäftigt.
Viel Berufserfahrung ist da, bei der Aktualität hapert es in manchen Fächern vielleicht etwas. Mit der Auflage zur didaktischen Weiterbildung hat man zu lange gewartet und es ist verständlich, dass viele ab einem bestimmten Alter keine Lust mehr haben, Kurse mit den Neuen zu besuchen.
Die Schule hat ein anerkanntes Quailtätszertifikat (ISO, TQM, eduQua) und es gibt einen Qualitätsverantwortlichen, der direkt der Schulleitung untersteht.
Ja, alles da. ISO-Zertifikat und Drumrum.
Es besteht ein attraktives Weiterbildugsangebot für Lehrpersonen.
Ja, das besteht.
Unter den Lehrpersonen finden pädagogische Konferenzen und Austausch statt.
Konferenzen sind eingentlich nur Informationsanlässe und haben nichts mit Pädagogik zu tun. Der Austausch ist mehrheitlich freiwillig und darum zu wenig.
Lehrpersonen besuchen sich gegenseitig im Unterricht.
Ja, machen wir. Ich mindestens einmal im Jahr.
Lehrpersonen werden regelmässig im Unterricht durch einen ausssenstehende Fachkraft besucht und beurteilt.
Nein, dazu gibt es keine Pflicht und kein Konzept. Ich bin eine Ausnahme mit Branchenkunde, ich werde manchmal von Aussenstehenden besucht (von der Gewerkschaft, von Kolleginnen aus anderen Schulen, von Verbandsvertreterinnen). Aber beurteilt werde ich nicht, ausser ich gebe einen Fragebogen ab.
Alle Beteiligten schätzen ihre eigene Leistung ein.
Ja, Lehrpersonen neu. Doch bei Lernenden hängt es von der Lehrperson ab.
Lehrende und Lernende verfolgen ihren Lernverlauf aktiv und ermutigen sich gegenseiteig, Erkenntnisse auf verschiedene Bereiche zu übertragen.
Hängt allein von der Lehrperson ab, es läuft aber in unserer Abteilung viel Motivierendes.
Das Beurteilungssystem regt an, sich über Verbesserungen Gedanken zu machen und fördert selbstverantwortliches Lernen.
Zum Teil. Die Unterrichtsbeurteilung zu Handen der Lehrpersonen auf jeden Fall. Die Notentabellen und Zeugnisse eher nicht, es fehlt die Besprechungszeit. Ich habe schon das eine oder andere versucht, aber es war ein Stress. Ich wünschte mir, die Klassenlehrpersonen hätten pro Jahr einmal eine Lektion für jede Schülerin/jeden Schüler Zeit, eine Standortbestimmung zu machen.
Die Schule hat eine neutrale Beratungs- oder Fachstelle, die bei Problemen konsultiert werden und für Moderationen zugezogen werden kann.
Ja, haben wir. Aber sie ist unterdotiert.