Mutter:
Kind, hast du dich jetzt entschieden, was du dem Mädchen antwortest, das dich liebt?
Kind:
Nö- ö.
Mutter:
Hmm. Nun sind aber doch die vereinbarten 14 Tage Bedenkzeit um? Hat sie so viel Geduld?
Kind:
Sie tut schon während der 14 Tage so, als ob ich mit ihr gehen würde, ohne meine Antwort abzuwarten. Dauert eh höchstens noch eine Woche, dass sie mich liebt.
Vater:
Wie kannst du da so sicher sein?
Kind:
Dank ein wenig mathematischem Geschick. Sie hatte neun Freunde [zählt alle neun Namen an den Fingern ab] in einem halben Jahr. Das macht knappe drei Wochen pro Freund.
Mutter:
Würdest du dir denn wünschen, dass sie dich noch länger liebte?
Kind:
Also… ja. Es ist immer gut, wenn man eine hat, die einen liebt. Es ist wie mehr Geld auf deinem Konto als du verdient hast, ein zusätzliches Guthaben halt.
Kategorie: Leben daneben
Ausserschulisches und Vermischtes
Rückfutter
Am Karikaturenstreit-Drehbuch soll ich nicht mehr mitschreiben, meint die Familie.
Mann:
Ich krieg Beulen, wenn ich noch einmal etwas zu dem Thema ertragen muss, wozu hab ich denn keinen TV!
Kind:
Viele suchen einfach irgend einen guten Grund zu kämpfen, ist doch gaga. Aber das haben die Ritter ja auch immer gemacht, sonst fühlten sie sich nicht nützlich.
Meine Mutter:
Reine Männer-Selbstdarstellung. Am Ende werden sie noch den Angriff auf den Iran mit diesem Affentheater rechtfertigen. Ich kann es nicht mehr hören!
Meine Schwester:
(seufzt enerviert)
Mein (muslimischer) Schwager:
Ich bin nicht beleidigt, danke.
Und es gibt noch andere, die die Ruhe weg haben. Wie Asad Suleman, der über Fallgruben hüpft oder Salman Rushdie, der im Glück die Heimat findet.
Dank Blog-Abstinenz habe ich nun meine Zeitungslektüre aufgearbeitet. Und die Familie hat schon Recht, es wird Zeit, dass ich mich wieder anderem zuwende als dem Kulturkampf. Auch wenn er mir in seiner Unsachlichkeit, die Gewalt eigen ist, grosse Sorgen bereitet.
Jetzt suche ich erst einmal meine Notizen zum Tischgespräch über die Liebe.
Pause

für eine Woche.
SMS aus dem Skilager
oder „vom effizienten Umgang des Kindes mit seinen Eltern“.
1. Alles perfekt.
Das war die Antwort auf: Liebes Kind, geht es dir gut? Klappt es mit dem Schlafsack? Bist du eingerichtet? Viele liebe Grüsse von deiner Mutter.
2. Ja!
Das war die Antwort auf die nach langem Schweigen gestellte Frage: Lebst du noch? Fragt dein Vater.
3. Klar, die waren super!
Das war die Antwort auf die Mutter-Frage: Sind die 50 Nussgipfel eingetroffen?
4. Ja.
Und dies war die Antwort auf die Vater-Frage: Geht es gut mit dem Ski fahren und besonders mit den gemieteten Carving-Brettern?
carica tu(r)ez!

Alles darf karikiert werden. Auch M… Mona Lisa.
[Dies ist ein Beitrag zum Thema Selbstzensur. Mit freundlicher Unterstützung von Fluïde Glacial & Angoulême. Dieses Jahr noch ohne Bombenanschläge.]
Zum Blödesten…
…gehört der Herbstschulbeginn. Ich will ihn nicht rückgängig machen, auch mir ist klar, dass wir uns anpassen mussten.
Es sind nicht nur die fallenden Blätter, die den Start ins neue Schuljahr begleiten, die mich stören. Es ist auch das deplazierte Semester-Ende, das in der Folge zwischen Weihnachten und einer kargen Sportwoche Anfang Februar zu liegen kommt, nur damit das neue Semester dann immer noch im tiefen Winter beginnen kann.
Jedenfalls verbringe ich meine Zeit mit dem Erstellen von Nachholtests (bei denen mich die Nachholenden dann in 60% der Fälle doch versetzen), mit dem Aushandeln von neuen Terminen für Referate und mit dem Abziehen von Punkten, weil sie schliesslich immer noch zu spät gehalten werden. Daneben überquillt die Mailbox von Anweisungen zur Notenabgabe und Absenzenkontrolle. Es dauert nicht mehr lange, so kommen schon die Befehle, wann wie und wo die Fragen für die Lehrabschlussprüfungen erstellt und deponiert werden müssen. Auch dafür stehen keine „Ferien“, die unter Lehrpersonen „unterrichtsfreie Zeit“ heissen, zur Verfügung, denn der Abgabetermin liegt vor Ostern.
Ich bin ziemlich belastbar, aber in diesen Wochen platzt mein Kopf und ich muss viel Echinaforce spicken, um nicht krank zu werden und meinen Aspirin500-Vorrat griffbereit in der Jeans haben.
Gut, dass es so viele Bloggerinnen und Blogger gibt, die die Themen, die mich interessieren, auch beackern. Lanu hat nach ihrem einfachen Neustart nun wieder eine richtige BooCompany auf die Beine gestellt und gute Presse dafür bekommen, gratuliere! Der eDemokrat will wie ich mehr Demokratie in Europa. Die Kaltmamsell hat nicht nur Solutions für den Pain Factor „Korrigieren“, sondern auch eine schöne Buchbesprechung (die Kommentare dazu sind ebenfalls sehr lesenswert), während Herr Rau den Austausch zwischen den Lernenden fördert, was ich für eine der wichtigsten neuen Lernformen halte.
Schlecht hingegen, dass sich meine Befürchtungen in anderer Sache so schnell bewahrheiten. Egal wie offensichtlich die Fehler sind, wir leben in einer Spargesellschaft, die ihren Mangel an Sachverstand und Effizienz einfach nicht zu überwinden weiss. Für den Hinweis danke ich Marian Wirth, der mich immer wieder mit Informationen aus der EU, zu der ich bekanntlich nicht gehöre, beliefert.
Engagierte Vermutungen
Ich verfolge eher fasziniert als schockiert, wie Menschen, die die Welt um sich herum verbessern möchten, der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Noch sind es weniger einzelne, die schlecht gemacht werden, viel mehr sind es Wörter und Wendungen, die den persönlichen Einsatz als solchen zum Witz stempeln.
Wir haben diese Mode willig aus Deutschland importiert. Ich möchte mich nicht zu lange mit den Gründen aufhalten, doch sogar ich habe verstanden, dass unter anderem Verblendung dazu geführt hat. Zusammenleben klappt nicht einfach von selber und diese Tatsache zu ignorieren, hat sich noch nie als besonders weitsichtig erwiesen.
Wie treue Mitlesende wissen, rede ich Probleme nicht schön. Aber ich mag es auch nicht zu kompliziert machen und wiederhole oft das selbe: Die Qualität unserer Volksschulen ist ungenügend (sowohl Deutschland wie die Schweiz haben sich ihren PISA-Schock redlich verdient) und die Anpassung von Migrantinnen und Migranten an unsere Regeln ist eine Bedingung, auch wenn die Bewertung des Integrationsniveaus eine Herausforderung ist.
Mit Aufkommen der „Political Correctness“ konnte sich Lorbeeren holen, wer gerade diese beiden Problemfelder durch die rosarote Brille betrachtete und sich über einen Schritt nach vorne freute, auch wenn’s zwei zurückging. Logisch und richtig, dass die Reaktion darauf nicht ausblieb, nur leider fand sie kaum auf das politische Parkett, welches sich Leute teilten, die soziale Gerechtigkeit entweder gar nicht in ihrem Wortschatz oder eben in Form der rosaroten Brille auf hatten. So brach sich die Pauschalpolemik erfolgreich Bahn. Unterstützt von der „Abgrenzung“, der von Büchern und Therapien empfohlenen Abkehr vom „Helfer-Syndrom“ und dem Wunsch nach Befreiung (von Parteienmief und Vereinsmeierei), avancierten die beiden absolut positiv besetzten Wörter „gut“ und „Mensch“ in Kombination zum Schimpfwort.
Ich hörte „Gutmensch“ erstmals von Eike Gramss, es muss Anfang der Neunzigerjahre gewesen sein. Er war noch nicht lange Intendant in Bern, als er die Bezeichnung in der Buchhandlung benutzte, nebenbei zwar, aber eindeutig negativ. Ich erinnere mich noch, dass ich mich gefragt habe, warum er nicht den guten alten „Weltverbesserer“ bemüht?
Mir fallen neue Wörter schnell auf. Gerade wenn sie von den an Eloquenz überlegenen Deutschen kommen, beobachte ich gerne ihren Weg in unsere Münder. Beim „Gutmenschen“ hat es gedauert. Aber dafür war er effizient genug, die „Multikultur“ zu integrieren.
Mein neustes Beispiel kommt aus dem „notebook“, einer Beilage zu der von mir sehr geschätzen und abonnierten Zeitschrift „kult“. „notebook“ funktioniert wie ein Offline-Gemeinschaftsblog, in dem verschiedene Leute sich zum Tage äussern. Ende Monat wird das dann als Rückblick gedruckt. Auflage 30’000 Exemplare, was für unsere Verhältnisse ganz ordentlich ist. Urs Meier schreibt in „notebook 3“:
Kindererziehung im Iran: Heute habe ich den schlimmsten Bericht seit meiner Geburt per Presse-Fotodoku zur Kenntnis nehmen müssen: Im Iran wird ein achtjähriger Junge auf den Boden gezwungen, muss seinen Arm ausstrecken, um ihn von einem Auto überfahren zu lassen. Ein Mann mit Mikrofon kündigt die Folter dem gnädigen Publikum an. Der Junge hat blanke Angst in den Augen, schreit vor Schmerz, der Wagen fährt über seinen Arm, hält an… An alle Multikulti-Gutmenschen: Nein, versucht’s gar nicht. Mir zu erklären, mich zu beschwichtigen. Könnte ja sein, dass das so sein müsse… (…)
Meine Vermutung ist nun, dass das nächste Wort, das ins Gegenteil verkehrt wird, „Engagement“ sein wird. Engagierte Menschen werden die Neogutmenschen des Jahrzehnts werden! Und Henryk Broder war schon mal so nett, mich zu bestätigen. Bei seiner Filmbesprechung „Der ewige Gute“ hat er seine Pointe extra dafür richtig weit hergeholt:
Nun muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden – dass der Film tatsächlich in den Schulen gezeigt wird, als Ersatz für den Sozialkundeunterricht. Denn es gibt nur eines, das schlimmer ist als engagierte Filmemacher: engagierte Lehrer.
Eigentlich verstehe ich mich nicht schlecht darauf, mit dem Lehrerbashing in der Presse umzugehen, als Buchhändlerin und Gutmensch habe ich ja schon ein wenig Übung. Hätte ich jedes Mal einen Buchstaben aus meiner Tastatur gebissen, wenn einer „die Lehrer sollen ihre Hausaufgaben machen“ krakeelte, hätt‘ ic l¨ngst k in Buc st b n m r.
Manchmal gelingt mir die Trasformation, ich verblogge den Mist und es gibt mehr Buchstaben anstatt weniger. Ätsch.
Genbaku

Gen: Wurzel, Quelle, Ursprung
Genbaku: Atombombe
Genki: voller Leben
Ich gab meinem Hauptcharakter den Namen Gen in der Hoffnung, dass er eine Wurzel und Quelle der Kraft für eine neue Generation der Menschheit sein kann – einer Generation, die die verbrannte Erde von Hiroshima barfuß betreten, die Erde unter den nackten Füßen spüren kann und die Kraft hat, „Nein“ zu sagen zu nuklearen Waffen. Ich selbst versuche mit Gens Stärke zu leben – das ist mein Ideal und ich werde dies in meiner Arbeit weiter fortführen.
Das sagt Keiji Nakazawa im ersten Band seiner Reihe: „Barfuss durch Hiroshima“. Das Vorwort zur Neuauflage von 2004 hat Art Spiegelman geschrieben, der Autor und Zeichner von Maus I und II.
Schliesst sich der Kreis? Braucht diese Welt noch einen A-Bombenabwurf? Sind wir alle zusammen reingefallen? In eine riesige Gedächtnislücke?
Chirac hat bestimmt das obligate Regal mit Bandes Dessinés zuhause, wie jeder andere Franzose auch. Aber er hat sie wohl nicht gelesen, die komprimierten Fehler des 20. Jahrhunderts, wie sie Nakazawa und Spiegelman aufgezeichnet haben. Und Ahmadinedschad würde Comics, hätte er welche, betend dem Feuer übergeben. Dringend filmen lassen wollen sich alle beide. Die Staatsmänner des neuen Jahrhundertshunderts feilen an einer passenden Rhetorik: Ignoranz und Provokation.
Was sind wir für eine Menschheit.
Argumente für einen Unterschriftenbogen
Deshalb sammle ich Unterschriften.
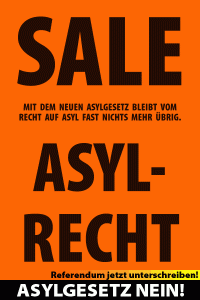
Für ihr Engagement und ihre Grafik danke ich Esther.
Suisse miniature
Ende des letzten Jahres korrespondierte ich mit einem Politwahlverwandten aus Deutschland. Wir haben uns über den Liberalismus-Trend in deutschsprachigen Blogs unterhalten:
Deutscher:
Ich habe in den deutschen Blogs noch keinen Liberalen gefunden, der versucht hätte, mich zu sich herüberzuziehen. Im Gegenteil: SPD=Sozialismus=Kommunismus=Maoismus. Ende der Diskussion.
Schweizerin:
Das ist in der Schweiz offenbar ganz anders, aber innerhalb wie ausserhalb der Blogosphäre. Es liegt wohl an den Abstimmungen, die gewonnen werden wollen.
Deutscher:
Na, DAS nenne ich mal einen interessanten Unterschied! Muss ich mir unbedingt merken, falls ich mal wieder mit einem Genossen aneinander gerate, weil der meint, unsere repräsentative Demokratie biete ausreichende Möglichkeiten für das Wahlvolk, sich zu beteiligen! (Gerade auf EU-Ebene halte ich die deutsche repräsentative Demokratie für eine Katastrophe. Es kann doch nicht sein, dass in einigen Ländern über jede EU-Vertragsänderung abgestimmt wird – und bei uns kungeln das die drei oder vier massgeblichen Fraktionsvorsitzenden untereinander aus und im Bundestag wird’s durchgewunken…)
Dabei haben wir gemerkt, dass wir gegenseitig wenig Konkretes über die Mitsprachemöglichkeiten im anderen Land wissen. Darum erkläre ich den Einfluss des Schweizer Stimmvolkes nachfolgend superkurz, ohne Politologie und ohne viele Links. Einfach frisch von der Leber weg und an drei Beispielen. Mein Hirn ist meine Quelle:
Volks- und Ständemehr unterscheid ignoriere ich vorerst und darum war’s das. Abläufe und Agenden sind immer neutral und verlässlich auf parlament.ch deponiert.
Warum ich selber gerade Unterschriften sammle, begründe ich im nächsten Eintrag. Heilige Lehrerinnenpflicht, hin und wieder ein Länzchen für die „Realpolitik“ zu brechen.
