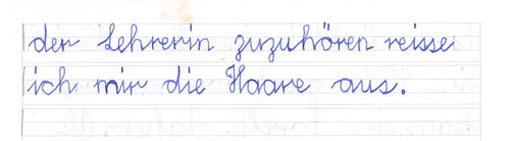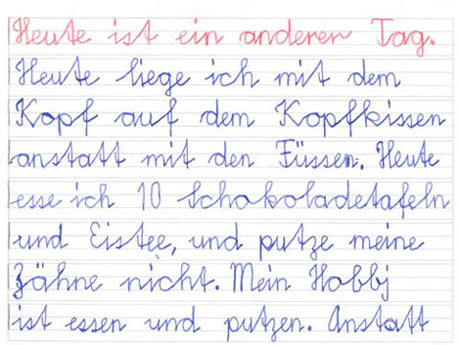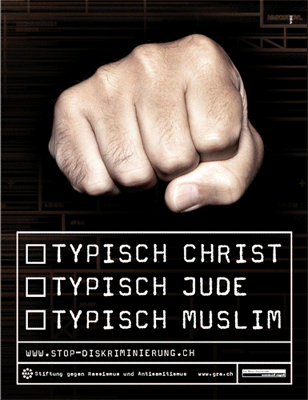Ich bedaure, dass die Konflikte in den Ghettos europäischer Städte auf Konflikte mit Migranten reduziert werden. Ich möchte auf den Artikel „Aufruhr in Eurabia“ bei SPO eingehen. Die meisten Links werden zu blogk führen, einem Weblog, das das Leben in einem Blockquartier am Stadtrand Berns dokumentiert.
Der Traum eines friedlichen Multikulti-Miteinanders zerplatzt.
Dieser Traum hat nie existiert. Was existiert, ist seine leere Hülle. Die gleiche Hülle bezeichnet das andere Lager mit „wird nie funktionieren, die haben halt eine andere Kultur!“.
Diese Hülle, egal welcher Aufschrift, diente seit jeher dem Zweck, willkürliches Tun zu rechtfertigen. Ziellos und mit den Mitteln, die eben gerade zur Verfügung standen, in die Richtung, die im jeweiligen Land gerade trendy war, wurde Quartierarbeit gemacht. Man hielt es mit den Aussenquartieren, wie am Anfang mit der Entwicklungshilfe: hie und da etwas ausprobieren und wenn’s nicht klappt, erfährt’s ja keiner.
Dilain ist Sozialist und Vizepräsident des französischen Städtetages. […] Clichy-sous-Bois besteht förmlich aus Schulen, Mutter-und-Kind-Zentren, Sozialbüros, Parks und einem Collège wie aus dem Architektenwettbewerb. In der Stadtbibliothek läuft der Aufsatzwettbewerb „Ich komme von fern, mein Land hab ich gern“.
Claude Dilain ist seit zehn Jahren Bürgermeister von Clichy-sous-Bois. Er gehört sicher zu denen, die „Integration“ als Aufgabe sehen, die durchdacht, gut strukturiert und ohne zu knausern gemacht werden muss. Er erinnert mich ein wenig an Boris Banga, den Stadtpräsidenten von Grenchen. Grenchen ist eine Kleinstadt, einst reich durch die Uhrenindustrie, heute verarmt und mit einem überdurchschnittlichen Arbeitslosen- und Ausländeranteil. Banga tut sein Möglichstes, der Verlotterung beizukommen und hat es mit seiner Forderung nach dem Kopftuchverbot in Schulen bis in die Boulevardpresse geschafft. Seine Probleme sind bekannt, aber er hat kein Geld.
Die Secondos und Secondas in Europa sind inzwischen vierzig Jahre alt! Die vertane Zeit müssen nicht nur die Stadtpräsidenten und Bürgermeister teuer bezahlen. Wir haben nicht einfach ein „Eurabia“ in den Ghettos, wir haben den Import von Mafia-Strukturen aus der ganzen Welt erlaubt und den Frauen nie zugehört. Zum Beispiel Samira Bellil, auf die ich schon an anderer Stelle hingewiesen habe, wurde in Frankreich bis zu ihrem Tod kaum wahrgenommen.
Das Armutsproblem (geistige Armut ist mitgemeint) in Europa beschränkt sich nicht allein auf arabische Migrantinnen und Migranten, es trifft auch Einheimische, überall. In der Schweiz zum Beispiel regiert seit fünfzehn Jahren Sparpolitik auf Kosten der Grundversorgung an Bildung, Kultur und Sozialwesen. Diese nagende Minderung der Wirksamkeit von Massnahmen fördert die Ghettoisierung, die Radikalisierung, sie verhindert Gleichheit und besonders effektvoll die Entwicklung von Intellekt.
„Die Logik dieser Unruhen“, sagte ein Polizeioffizier, „ist die Sezession“ – die Abtrennung und Verselbständigung ganzer Viertel und Gemeinden, Zonen eigenen Rechts, zu denen die Staatsmacht keinen Zutritt mehr hat, wenn sie nicht als feindlicher Eindringling empfunden werden will.
So ist es. Aber warum waren die nicht jeden Tag da? Warum fährt die Polizei nicht seit dreissig Jahren regelmässig Streife in gefährdeten Siedlungen? Ich und viele andere haben diese Frage hier in Bern oft gestellt und es hat sich gelohnt. Dennoch ist die Polizei so knapp dran, dass die Polizeistreifen in die Villenviertel Aussenquartiere jederzeit wieder gestrichen werden könnten.
Die Kampfzone weitet sich aus, wie es der bleiche Autor Michel Houellebecq in seinem Bestseller formuliert. Und es sieht ganz danach aus, als würden die wurzellosen Zuwanderer das Leben in Europa auf dramatische Weise verändern.
Dieser Abschluss widerstrebt mir als Buchhändlerin. Wer an Fachlichem nicht interessiert ist, verzichte aufs Weiterlesen.
„Ausweitung der Kampfzone“ (Orig. „Extension du domaine de la lutte“ ) von Michel Houellebecq war leider noch kein Bestseller, sondern vielmehr ein Geheimtipp, von Wagenbach entdeckt und mit Verzögerung von fünf Jahren ins Deutsche übersetzt. (Houellebecq ist danach den dicken Checks gefolgt – dass er jetzt bei Dumont erscheint, macht seine Literatur nicht besser.)
Die Geschichte erzählt ein Programmierer, der hauptsächlich für das französische Landwirtschaftsministerium arbeitet. Ausser an zwei Araber, von denen einer vor dem Protagonisten auf den Boden spuckt, kann ich mich an nichts erinnern, das in einem Zusammenhang mit „Eurabia“ stehen würde.
Doch der Begriff „Kampfzone“ ist ein Zufallstreffer. Er wird bei Houellebecq benutzt als das, was Kinder ausweiten, wenn sie in Kriegsspielen nicht mehr mit Plastiksoldaten, sondern eine Rolle spielen, das was man dehnt, wenn man die Regeln hinter sich lässt, das, was dazwischen liegt, wenn man am einen Ufer losschwimmt und es weder ans andere noch zurück schafft. Als Ausweitung der Kampfzone bezeichnet er die Erkenntnis, dass das Leben nichts kann als misslingen.
Wenn schon als Aufhänger verwendet, hätte eine genauere Lektüre von Houellebecqs Erstling dem Artikel bestimmt nicht geschadet.