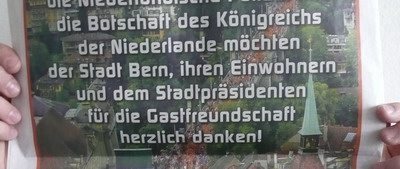Ich habe aufgeräumt (die Schulzimmer, meine beiden Bürotische), ich habe geleert (meine vielen Fächli vom Lehrerzimmer übers Postfach bis zum Quartierzentrum), ich habe aktualisiert (die Verienswebsite, die Politwebsite, die Schulwebsite), ich habe gebügelt (mein Leinen-knittert-edel), ich habe geputzt (mithilfe vom Kind) und gepackt (mithilfe vom Kind), ich habe gekauft (in Buchhandlungen und Apotheken), ich habe geladen (das ganze Elektronikzeugs, das man heutzutage braucht), ich habe gedankt (denn die gute Arbeit überwiegt eben fast immer und überall), und ich habe Stapel vom immer noch Unerledigten gemacht, die sich recht klein ausnehmen.
Dieser eine Augenblick im Jahr, in dem ich nicht das Gefühl habe hinterher zu hechten, weil inzwischen jeder weiss, dass ich im Juli nicht zur Verfügung stehe, ist echt befriedigend.
My Hometown
Green, Green Grass Of Marzili on 5th July 2008.
Sehnsucht nach Sachlichkeit
[Vorsicht bei der zweite Hälfte: Jammerbeitrag.]
Ich streite mich gerade mit mir selber darüber, ob die Arbeit einer Lehrerin oder eines Lehrers auf Schuljahresende zu- oder abnimmt. Einerseits sind immer weniger Lernende da, weil ja die Abschlussklassen nicht mehr zur Schule kommen, sobald sie die Prüfungen abgelegt haben. Bei uns bewegten sich dieses Jahr beispielsweise 1029 Lernende weniger „auf der Anlage“ (wie das die Hausmeister zu nennen pflegen), was unseren Alltag durchaus veränderte.
Eigentlich mag ich diese Zeit. Die Lernenden aus den laufenden Lehren haben Zeugnisschluss und es gibt nur noch einige Nachholtest zu schreiben und zu benoten. Wir befassen uns mit Bedürfnisabklärungen fürs nächste Schuljahr, machen Zufriedenheitsumfragen, gehen vielleicht noch einmal kurz auf Dinge ein, die weniger gut gelaufen sind und bedanken uns besonders für gutes Verhalten und angenehme Zusammenarbeit. Klassen, die auf das neue Schuljahr neue Lehrpersonen bekommen, schreiben Abschiedskarten für die alten und gehen Glacé essen. Wir bereinigen Uneinigkeiten bei Absenzen und versuchen auch dann noch einigermassen bedeutsam zu unterrichten, wenn es nicht mehr relevant für die Noten ist.
Obwohl viele Kolleginnen und Kollegen davor gewarnt hatten, ihr Kerngeschäft zugunsten von Bürokram vernachlässigen zu müssen, hat mich der administrative Aufwand, der vor allem am Ende und Anfang von Schuljahren anfällt, lange kalt gelassen. Für eine Backoffice-Tante des Buchhandels ist Administration höchstens positiver Stress. Heute jedoch schaffe auch ich es nicht mehr, die Beurteilungen, Kommuniqués, Verordnungen, Klasseneinteilung, Stundenplan-Feinplanung, Materialgelderhebungen, Lehrmittellisten, Softwareevaluationen und Promotionsprobleme zu bewältigen. Das heisst konkret, dass ich das – will ich es nicht nur halbpatzig machen – in den Schulferien tun muss. (Erzählte mir das jemand, der so wenig wie ich unterrichtet, hielte ich ihn garantiert für ineffizient.)
Die Hälfte der schulfreien Zeit reicht für die qualitativ hochstehende Bewältigung administrativer Schul-Arbeit aus, denn man kommt bekanntlich rasch vorwärts, wenn man nicht unterbrochen wird. In der anderen Hälfte der Schulferien kann ich den eigenen Unterricht vorbereiten, die Planungskonferenzen zum Schulstart besuchen, die eigene schulische Weiterbildung machen und an Tagungen und Kursen der Buchbranche teilnehmen.
Würde der Mensch keine Erholungszeit brauchen, ginge das wunderbar. Nur leider zeigen die im mit Burnout ausgeschiedenen Lehrerinnen, Lehrer und Schulleiter ein anderes Resultat, nämlich „Error“. Und jeder, der fehlt, muss ersetzt werden: Klassen warten, Termine sind gesetzt. Und weil die Entwicklung der Lehrer-Roboter noch immer sträflich vernachlässigt wird, müssen Fehlende entweder von erfahrenen längst Ausgelasteten oder von neuen noch Unerfahrenen ersetzt werden. Und beide bräuchten Hilfe, die nicht zur Verfügung steht. Dass das dann wiederum neue Ausgebrannte zur Folge hat, ist einfach auszurechnen.
Der Umgang mit den Herausforderungen der Schule kommt mir vor wie der Umgang mit den Herausforderungen der Migration: Politik und Gesellschaft bewegen sich zwischen Schönrederei und Verdammung. Logik und Sachlichkeit bleiben chancenlos.
Danke für die Blumen
Gestern hatten wir Abschlussfeier. Sehr, sehr schön: Duft von Mont-Vully-Rosen in der Luft und berieselt mit Dank und Komplimenten. Auch wenn man sich bekanntlich nie zufrieden geben sollte (sonst ist Weltenende oder Leistungsgesellschaftsende oder was auch immer) sehe ich an solchen Anlässen vor allem eins: Einen sympathischen Haufen deutschschweizer Buchhändler mit Esprit.
Und ich denke, zu einem solchen Klüngel zu gehören, ist weissgott nicht das schlechteste, was jungen Menschen passieren kann.
Weil ich selber viel reden durfte, konnte ich den Anlass nicht gleichzeitig noch dokumentieren. (Übrigens schön, wie mich immer wieder Leute nach meinem Blog fragen und gestern auch jemand, weshalb ich weniger schriebe? The answer, my friend, is blowin‘ in the blog.)
Jedenfalls ist meine fotografische Ausbeute so dürftig, wie ich anderweitig beschäftigt war. Aber dafür habe ich mein Lieblingsbild aus der Vorbereitungsphase, als die Floristin noch da war und wir Buchhändlerinnen-Lehrerinnen mit Kochschürzen über Bügelfalten herumrannten und dekorierten:
Independent Booksellers Week

Nach den USA finden die „Indies“ auch in UK zusammen. Bereits vor einiger Zeit hat The Booksellers Association im Zuge der Kampagne „Love Your Local Bookshop“ eine Website mit Warenkorb aufgeschaltet. Usability-mässig noch nicht ganz konkurrenzfähig, aber das wird schon.
Für das Kundenbewusstsein werden prominente Autoren in der Aktionswoche in den Indie-Bookshops beraten und Bücher verkaufen. Der Ire Joseph O’Connor zum Beispiel ist bei „Strictly Come Bookselling“ ganz vorne dabei. Er kann von mir aus gern ein Jahrzehnt nach dem Verkäufer auch den „Buchhändler“ litererarisch verarbeiten (und Übersetzung bitte wieder beim unabhängigen Zürcher Ammann, danke).
Vielen meiner Leserinnen und Leser ist klar, wozu Unabhängige gut sind, deswegen lasse ich die Predigten weg. Wer noch etwas wissen will, frage ungeniert.
Zwei Gründe
gibt es für eine Buchhändlerin, ihre Lieblingsstelle in einem Buch zu suchen.
1. Das Buch ist schlecht.
2. Das Buch ist gut.
Bei 1. hat sie so immerhin ein Verkaufsargument, bei 2. versucht sie, die ganze Güte dadurch kundererträglich zu filtern.
„Beides“ sagte Sabrina Jones, ohne zu zögern, aber ich war mir sicher: wenn die Welt aufhören würde, sich Kriege und Hungersnöte und andere Gefahren zu leisten, so wären die Menschen immer noch in der Lage, einander in tödliche Verlegenheit zu stürzen. Unsere Selbstvernichtung würde auf die Weise vielleicht etwas länger dauern, aber ich bin überzeugt, sie wäre nicht weniger vollkommen.
„Das Hotel New Hampshire“ von John Irving ist ein starkes Buch. Ich bedanke mich bei Herr Rau.
Sun King
Dieses Lied lief mir den ganzen schweisstreibenden Tag hinterher – und es kommt selten allein. Dank seiner Melodie von „Here Comes The Sun“ und dem Übergang zu „Mean Mr. Mustard“ singt es mindestens dreifach im Kopf.
„Mean Mr. Mustard“ ist auch so ein Stück, welches mir seit Kindeszeiten vertraut, aber immer unhinterfragt und auf völlig schräge Assoziationen beschränkt geblieben ist. Bis heute habe ich keinen Schimmer, was der Autor damit sagen wollte.
Aber Liedtexte aus der Kindheit sind komisch.
Tischgespräch [34]
[Dem Kind sein Toast ist runtergefallen]
Kind:
Shiiit! Genau mit dem Philadelphia gegen unten!
Vater:
Murphy’s law.
Kind:
Was?
Vater:
Murphys Gesetz.
Kind:
Besagt dieses Gesetz, dass die Seite mit mehr Masse mehr von der Erde angezogen wird?
Vater:
Nein. Dass von zwei gleich wahrscheinlichen Dingen das Unangenehmere passiert.
Kind:
Dann stimmt aber das Gesetz nicht, dass Katzen immer auf den Pfoten landen.
Vater:
Kann schon sein.
Kind:
Wenn wir es wissen wollten, müssten wir einer Katze einen Philadelphia-Tost auf den Rücken binden und …
Mutter:
Da brauchst du viele Versuche, um damit etwas zu beweisen. Widerspricht dem Tierschutzgesetz.
Kind [seufzt]:
Bestimmt.
Kurs um Kurs
Heute habe ich im fernen Zürich einen eintägigen Kurs über Kurse gegeben.
Klingt blöd, war aber gut. Eine halbe schlaflose Nacht (Lampenfieber) zwar, aber dank wohlwollenden Kursteilnehmenden ist es eine schöne, runde Sache geworden.
Ich weiss nicht, ob das in anderen Ländern auch so ist, aber bei uns sind Kurskonzepte ziemlich häufig und wichtig geworden. Zum einen, weil man für eidgenössische Anerkennung das Bedürfnis nachweisen muss. Das heisst konkret, man muss ziegen, dass eine Branche diese Leute sucht und einstellt, die man mit eidgenössischem Segen weiterbildet. Zum anderen wegen der Dynamik in der Berufswelt und besonders im Dienstleistungsbereich. Ein Weiterbildungskurs – ganz unabhängig ob national oder ein Nischenprodukt – den man über drei Jahre unverändert anbieten kann, ist heutzutage ein Longseller.