Heute war es lustig im Didaktikkurs. Verschiedene Differenzen sind zu Tage getreten und mit Humor genommen worden. Der Motivations-Text von stangl-taller war zu lang, um ihn in 20 Mintuen zu lesen und zu diskutieren (Evelyne, jetzt darfst du auf die Sternchen klicken). Und einige haben sich von den Fremdwörtern – egal ob Latein oder Englisch – gleich zu Beginn laut und deutlich sehr anschaulich demotivieren lassen.
Man könnte sogar sagen, die Fremdwörter haben sie so abgestossen, dass wir Fremdwort-Befürworter nicht umhin konnten, die Bezeichnung für die entsprechende Phobie zu suchen, wobei wir nur bis Xeno irgendwas gekommen sind. Meine Recherche hat nun die „Xenoglossophobie“ zu Tage gefördert, die das Problem mit „Fremdsprachenphobie“ leider nur ungenau beschreibt. Aber besser als nix.
Autor: Tanja
Haben wollen
Eine Kollegin wollte Anfang Woche etwas von mir. Etwas, was nichts mit der Schule zu tun hatte, nämlich Beratung zum Thema Usability von Websites. Dann wollte sie, dass ich die Navigation für eine Website mit Warenkorb entwerfe, die sie als Hobby betreiben würde. Ich mache derlei seit vielen Jahren, ich bin – auch wenn man das diesem Weblog nicht ansieht und das ist ja gerade das Erholsame daran – in diesen Dingen bewandert genug, um Aufträge zu bekommen und habe ihr meinen Preis genannt. Darauf hin ist sie ziemlich aggressiv geworden. Und ich habe pariert. Mit den üblichen Argumenten, die zu brauchen mir allerdings im Kopierräumchen ungewohnt waren. Argumentiert habe ich z.B. damit, dass wohl niemand auf die Idee kommen würde, einer Musikerin vorzuwerfen, dass sie in der Zeit, in der sie übt, auch ein Dach über dem Kopf haben muss? Und dass sie auch bedenken muss, dass sie einmal ein neues Instrument braucht. Und dass sie das im Preis für ihren Auftritt einrechnet. Es sind nicht alle Lehrerinnen und Lehrer und können auf eine (wenn auch unterschiedlich gute) Infrastruktur zurückgreifen. Ich bin sehr sachlich geblieben, war aber trotzdem ziemlich frustriert nach den Schimpftiraden als Reaktion auf meine mangelhafte kostenlose Kooperation (O-Ton: „heute ist das Kollegentum nichts mehr wert, heute geht alles bachab und wenn man etwas will, muss man es selber lernen, den Rest kann kein Mensch bezahlen“).
Heute ist die Kollegin zu mir gekommen und hat mir gesagt, sie hätte lange darüber nachgedacht und könne mich nun verstehen. Das sind Erfolge, wie ich sie nur in der Schule erlebe. Und es muss ja nicht immer eine Entschuldigung sein.
Guten Abend, März
Der gestrige Eintrag scheint uralt.
Und das liegt am Februar.
In der Kürze liegt, was nütze.
Unter dem Pflaster liegt der Strand.
Sein und Bewusstsein
Herr Rau hat in seinem Blog auf die Erkenntnisse der Freien Universtität Berlin aufmerksam gemacht (draufgekommen ist er via Xenon B.) , was ein guter Lehrer sei und hat darüber reflektiert. Ich habe die letzten Monate so oft reflektiert, dass ich mir jetzt einmal erlaube, das mehr allgemein zu kommentieren, als in Hinblick auf meine persönliche Entsprechung oder mein persönliches Versagen.
1. Ein professioneller Lehrer wählt seinen Beruf primär in Hinblick auf die Berufstätigkeit, in zweiter Linie aufgrund des Fachinteresses oder aufgrund von Arbeitsmarktbedingungen.
Hmm. Die Aussage ist nicht besonders glücklich formuliert, deshalb kann ich ihr so nicht beipflichten. Es gibt durchaus professionelle Lehrpersonen, die aus Fachinteresse zum Beruf gekommen sind.
Aber wenn das bedeuten soll, dass das Lehrperson-Sein das Lehrperson-Bewusstsein bestimmen sollte und nicht das Fachperson-Sein, dann finde ich das auch. Wenn ich zurückschaue auf meine eigene Schulkarriere, habe ich als Schülerin mangelnde Fachkompetenz immer besser kompensieren können als mangelnde soziale oder pädagogische Kompetenz.
2. Er hat ein mehrfaches Selektionsverfahren und eine professionelle, berufsbezogene Ausbildung hinter sich gebracht.
Ja, das sollte so sein. Und zwar unabhängig davon, ob jemand quer einsteigt (wie ich zum Beispiel) oder nicht. Natürlich richtet sich die Dauer und Intensität der Ausbildung nach den Anforderungen einer Schule. Einer, der angehende Schreiner in Holzkunde unterrichtet, braucht nicht eine gleich lange Ausbildung wie eine Physiklehrerin eines Gymnasiums. Aber beide brauchen didaktisches Rüstzeug und müssen weitergebildet oder ersetzt werden, wenn sie die Lernziele über weiter Strecken nicht erreichen.
3. Er nimmt regelmässig an Fortbildungsveranstaltungen teil und befindet sich deshalb auf dem jeweils gültigen Stand fachlicher und berufswissenschaftlicher Forschung, deren Resultate in das berufliche Handeln umgesetzt werden.
Jawohl. Auch das sollte so sein. Leider widersprechen die Arbeitsumstände diesem Ziel oft. Nicht zuletzt weil manche obligatorischen Weiterbildungen alle über einen Kamm scheren. Ich ärgere mich über den Zeitverlust, wenn ich wieder einen Grundkurs in „wie stelle ich den PC an“ besuchen muss, um ein Informatikzimmer benutzen zu dürfen. Andererseits bräuchte ich mehr Weiterbildung als mir zur Verfügung steht in Sachen Notengebung, vor allem für mündliche Arbeiten. Das muss ich mich vergleichsweise aufwändig von Kolleginnen und Kollegen und aus Büchern zusammensuchen.
4. Er hält angemessene Distanz zu Schülern und Eltern.
Ich finde eher, Lehrende sollten mit Lernenden zusammenarbeiten (deren Alter entsprechend natürlich) und deren Umfeld angemessen einbeziehen. Aber das ist realistischerweise nicht immer möglich. Wir sind schliesslich nicht in Finnland.
5. Er erwartet ein angemessenes Feedback über seine Arbeitsqualität von den Dienstvorgesetzten.
Ja. Angemessen heisst für mich vor allem regelmässig und dokumentiert und nicht einfach so anfallsmässig dann, wenn gerade wieder irgendwer aus Politik oder Elternrat das gefordert hat.
6. Er verfügt über die Fähigkeit, gültiges Wissen bei den Schülern entstehen zu lassen und dieses auch begründen zu können.
Wieder so eine merkwürdige Formulierung. Das Wissen der Lernenden sollte aktuell sein und sie sollten verstehen, warum und wozu sie es brauchen. Wenn Lehrende regelmässig begründen, ist das für alle Beteiligten sinnstiftend.
7. Er verfügt über technisch kontrolliertes Regelwissen des Unterrichtens und des Erziehens.
Erstrebenswert.
8. Er übt seinen Beruf souverän aus, das heißt, er bestimmt selbst den Ausnahmezustand, gegebenenfalls auch mit direktiven Mitteln.
Ja.
9. Er ist konflikt- und teamfähig.
Ja. Eine Lehrpeson ist besonders in diesem Bereich ein Vorbild und hat auch welche, möglichst im Kollegium. Sie schaut nicht auf andere herab.
10. Er hat eine optimistische Grundeinstellung.
Auf jeden Fall. Eine Lehrperson soll lächeln, nicht weniger als ein Diamantenverkäufer. Aber das hindert sie nicht daran, klare Regeln in Reserve zu haben und Mittel, diese durchzusetzen. Mir sind Lehrpersonen ein Graus, die immer alles optimistisch sehen, egal ob die Turnhalle auseinander fällt oder die Kinder einander den Kopf abreissen. Aber dafür steht wohl Nr. 8.
11. Er definiert klare Unterrichtsziele und führt einen klar strukturierten Unterricht durch.
Unbedingt. Dieses Ziel muss eine Lehrperson vor Augen haben. Aufgrund dessen reflektiert sie über Erfolge und Misserfolge. Die Resultate ihrer Überlegungen bezieht sie ein, wenn sie das Wissen der Lernenden überprüft und die Lernenden beurteilt. Wenn die Lehrperson mit Veränderungen und neuen Verordnungen konfrontiert ist, überprüft sie nicht als erstes, ob sie weniger Lohn oder mehr Arbeit hat, sondern, ob diese Ziele nicht behindert werden und sie den Kurs halten kann.
Wenn einer Lehrperson das (mehrheitlich) gelingt, dann hat sie auch ein realistisches Verhältnis zu den übrigen 10 Punkten. Und Argumente gegen Lohnabbau und grössere Klassen.
Lehrlingsauswahl
Ich habe eine Sondernummer unserer Schulzeitung „Pegasus“ verfasst. Und zwar zum Thema „Lehrlingsauswahl“, was ein ziemlich weites Feld ist. Natürlich geht es um Didaktik, aber die Didaktik im Lehrbetrieb läuft einfach anders als in der Schule. Sicher, es gibt eine Annäherung, weil die Zusammenarbeit auch im dualen System der Lehre mit jeder Reform intensiver wird. Es stehen sich nicht mehr einfach Schulunterricht und Praxiserfahrung gegenüber, viel mehr geht es in beiden Bereichen um Vermittlung und Erfahrung. Deshalb finde ich die Kommunikation zwischen Berufsschule und Lehrbetrieben auch so wichtig.
Ich habe mich für diese Tipps auf eigene Erfahrungen und die Erfahrungen anderer Ausbildungsverantwortlicher gestützt, sehr wenig auf pädagosiche oder psychologische Erkenntnisse. Ich dachte mir wenn ich zuviel reinpacke, wird das nicht mehr gelesen. Schliesslich stehen die Leute, die ausbilden, häufig auch unter Druck. Sie müssen unbedingt richtig wählen, sie haben vielleicht nicht so viel Zeit für die Auswahl, manchmal sagt auch jemand die Lehrstelle zu und viel zu spät wieder ab, ein anderes Mal fällt die Person aus, die normalerweise die Schnupperlehre durchführt und, und, und.
Doch ich kann zufrieden sein, die Sondernummer ist gut angekommen, ich habe einige positive Feedbacks erhalten und sogar der Branchenverband hat sich gemeldet und bedankt.
Pragmatisch, offen, aufs Äussere achtend
Das sei die Jugend heute, sagt mir die Shell-Studie 2002. Die zu studieren gehört zu meinen DIK1-Hausaufgaben. Auch wenn ich immer ein wenig Probleme habe mit dem Shell-Sponsoring (ich kann ja froh sein, dass nicht Philip Morris PISA bezahlt, ich weiss), lese ich diese Studien gerne. Denn wie will ich sonst damit klar kommen, dass ich mich immer mehr von den Realitäten der Jugendlichen entferne, genau wie ich mich von ihr (der Jugend) selber entferne? Meine Lernenden finden mich (Aussagen gemäss) recht cool und gut informiert. Ich selber fühle mich überhaupt nicht so, ich gehöre ja zur Generation Boris Becker, bin fünf Jahre älter als Eminem und habe von allem, was nachher noch kam, keinen Schimmer mehr.
Aber zurück zur 14. Shell Jugendstudie: Es wurden 2’500 Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren in Deutschland befragt, die Studie gilt als auf die Schweiz übertragbar (aber in der Schweiz gibt’s natürlich auch immer eine, die heisst irgedwas mit Trash, Link finde ich so auf die Schnelle gerade keinen). Wie gesagt, die Jugendlichen von heute sind pragmatisch, offen und achten auf die äussere Gestalt und Gestaltung. Auch die Gestaltung ihres Lebensraumes ist ihnen im Sinne eines politischen Engagements nicht unwichtig, aber sie muss Spass machen oder individuell konkrete Ergebnisse bringen. Der Leiter (?) der Studie Klaus Hurrelmann nennt das ein möglicherweise „urdemokratisches Gefühl“, was ich zu bezweifeln wage. Was die Leistungen angeht, gibt es zwei grössere Gruppen, die eine strebt eindeutig und absichtlich auf, will Leistung bringen und Leistung sehen, die andere tut das zwar ebenfalls, aber bezieht mehr Lebensbereiche in den Plan ein. Bei der zweiten Gruppe hat es mehr Frauen, ich denke, viele von ihnen sitzen bei mir im Schulzimmer, denn Buchhändlerin zu lernen braucht schon eine Überzeugung, die über Lohn oder Aufstieg hinausgeht. Die, die unglücklicherweise nicht zu diesen beiden Gruppen gehören, weil sie die Leistung nicht zu bringen in der Lage sind, fallen leichter durchs Netz als auch schon. „Hier ist die Gesellschaft aufgerufen, Integration zu leisten,“ meint Hurrelmann dazu und wohl die ältere Generation damit. Die Globalisierung wird ebenfalls sehr sachlich beurteilt. Die wachsende Mobilität wird geschätzt, dass internationale Produkte zur Verfügung stehen auch, die zentrale Frage bleibt: Was habe ich davon? Die Relevanz von Bildung ist unbestritten, auch wenn viele Jugendliche bedauern, dass die Schule sie zu wenig anspricht und ihnen zu wenig Freude bereitet. Ich bedaure das auch und gebe Gegensteuer, so gut ich es vermag.
Die Studie deckt sich zu einem Teil mit meinen Erfahrungen und mit dem, was ich sonst gelesen habe. Sie ist eine gute Zusammenfassung aber bringt für mich nichts Neues. Ich brauche bloss die Wahlergebnisse in Bern zu studieren und zu schauen, welche Vertreterinnen und Vertreter von Jungparteien die meisten Stimmen holen: Das sind gebildete, sachliche Leute, die sich nicht scheuen, das Wort Karriere in den Mund zu nehmen, keine Berührungsängste haben und durchaus gewillt sind, vor dem Pressefoto die Haare machen und die Augenbrauen zupfen zu lassen.
Ich denke, diese Generation liefert, wie jede vor ihr, was es braucht. Und wenn man international kommunizieren, national die Sozialwerke sanieren und lokal doch noch halbwegs glücklich sein will, dann braucht es eben solche Kompetenzen. Auch wenn mich die Abkehr vom Engagement aus moralischen Gründen, der Spassanspruch an die Politik und die permanente Kosten-Nutzen-Rechnung manchmal beelendet, ist es wohl genau das, was diese Generation an Basics nötig hat, um die Forderungen des Alltags zu erfüllen und das Überleben der Demokratien zu sichern.
Volksschule III
Ich wollte es lange nicht eingestehen, aber inzwischen bin ich zur Überzeugung gelangt, dass viele Repräsentantinnen und Repräsentaten der Volksschule meine Auffassung von Pädagogik und Bildung nicht teilen. Ich weiss sehr wohl, dass es auch andere gibt, nur leider ist die Trefferquote bei mir mit einem einzigen Kind sehr klein. Selber schuld.
Ich rede hier nicht von riesigen Gemeinsamkeiten und Visionen, sondern vom kleinsten gemeinsamen Nenner. Wie zum Beispiel, dass Ziele im Leitbild ernst genommen werden. Eben Ziele sind, nach denen man gemeinsam strebt und nicht Zeilen, die man unter den Tisch kehren kann.
Pädagogik ist Erziehungslehre und zu jeder Lehre gehört die Erfahrung, die andere schon gemacht haben.
Sicher, ich wohne in einem „schwierigen“ Quartier, aber ist das ein Grund, die Leitgedanken zu vernachlässigen? Eher das Gegenteil. Maria Montessori, Rudolf Steiner und Janusz Korczak haben mit Kindern aus der Unterschicht oder gar aus Elendsvierteln gelernt und genau in dieser Arbeit die Richtlinien für ihre Pädagogik gefunden. Und über diese Richtlinien werden heute Tausende von Seminar- und Doktorarbeiten verfasst.
Indes, alles Gesagte und Geschriebene, alles noch so logisch Durchdachte ist nicht das Wegweisende, und Korczaks Bedeutung liegt nicht darin, dass er es gesagt und aufgezeichnet, obwohl bei ihm Wort und Schrift sich durch ein Höchstmass an menschenmöglicher Empathie auszeichnen, sondern darin, dass er dem Gesagten und Geschriebenen nachgekommen ist mit der Tat.
Werner Licharz in: Janusz Korczak – Zeugnisse einer lebendigen Paedagogik (ich glaube, das ist ein Aufsatz im vergriffenen Titel: „Mehr als ein pädagogisches Credo,“ aber ganz sicher bin ich nicht.)
Ich könnte meine Ungehaltenheit gegenüber der Volksschule des Kindes vielleicht so ausdrücken: Bildung ist ein Menschenrecht. Ein Mensch, dessen Beruf es ist zu lehren, braucht also eine Haltung zum Lehren. Und diese Haltung können wir nur teilweise in Kursen vermitteln oder vermittelt bekommen. Diese Haltung müssen wir uns erarbeiten, genau wie der Arzt, der heute noch in Thailand Leichen identifiziert. Man kann ihm Stategien und Instrumentarien beibringen, aber die Haltung muss er sich erarbeiten. Und damit muss er in guten Zeiten anfangen.
Wenn es gut geht, bedeutet das nicht, dass man nichts machen kann.
Und wenn es schlecht geht, bedeutet das nicht, dass man nichts machen kann.
Poesiealbum 5
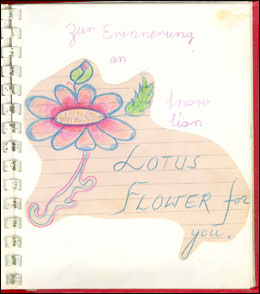
1978: Ich weiss nicht mehr, ob ein Mönch oder die gute Rigzin aus dem Guesthouse im Himalaya mir diese Blume gezeichnet hat. Jedenfalls habe ich sie ein Jahr lang aufbewahrt, um sie daheim ins Poesiealbum zu kleben.
2005: Leider weiss ich auch nicht, wo diese Menschen heute sind. Aber ich werde ihnen mein Leben lang dankbar und verbunden sein.
Light build
Unser Leitbild sei zu lang, sagen die Berater. Kürzer, treffender, Powerpoint ist nun angesagt und in der Vernehmlassung. Diese Kürzerei macht mir Mühe, diese zwei Sätze pro Seite sind mir ein Graus.
Ich frage mich, wie wir fair mit uns selber und anderen und sorgfältig mit dem Material und der Umwelt umgehen können, wenn wir es nicht schaffen, zehn Mal zehn Zeilen Prosa zu lesen und darin übergeordneten Ziele zu erkennen.
des Tages Fülle
Heute war ein prallvoller Tag, ich kann nicht mehr wirklich gerade stehen. Aber Bloggen geht ja im Sitzen.
Gut: Unser Perspektiveworkshop ist auch mit der Parallelklasse sehr gelungen und ich habe seit Montag schon dik’sche Verbesserungen anbringen können. Was befriedigend war.
Gut2: Ich habe heute die perfekte Übungslektion erlebt. Chapeau, Manuela (die Schneiderin)!
Gut3: Ich bin stolz auf meine letztnächtlich geschriebenen Buchtipps.
Schlecht: Ich bin praktikumsmüde, ich kann diese Kreise und Beurteilungen und Reflexionen fast nicht mehr ertragen.
Schlecht2: Mein Kind will (meines und Fachpersonen Erachtens aus guten Gründen) nicht mehr in die Schule. Es geht aber trotzdem und lässt seine Wut an mir aus, indem es mich mit Kissen und Schimpfwörtern bewirft.
Schlecht3: Meine Erwerbsarbeit steht in einem selten miserablen Verhältnis zur unbezahlten Arbeit und mein (einziges!) Konto zeigt CHF 9.75. (Obwohl ich natürlich als Schweizer Bürgerin über so etwas nicht reden, geschweige denn schreiben dürfte.)
Gute Nacht.
