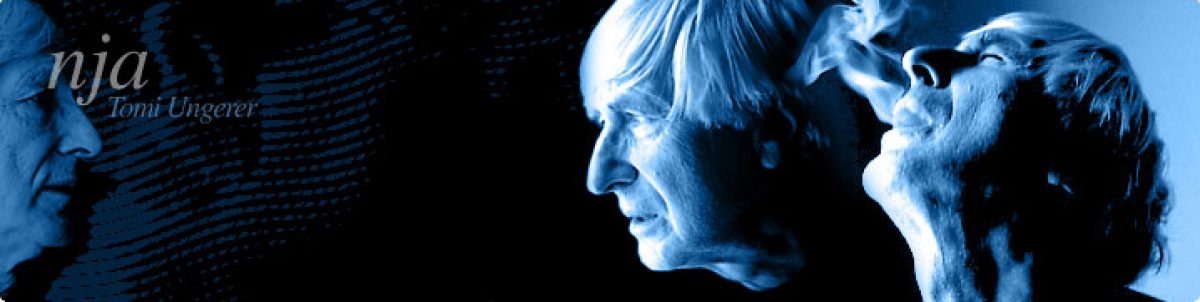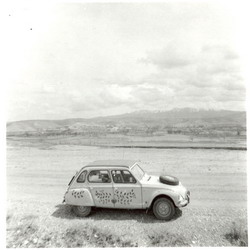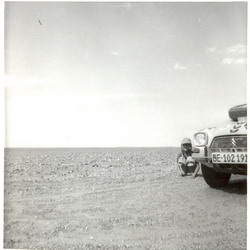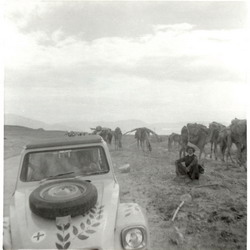Danke der Nachfrage, wir leben noch, auch als EM-Stadt, exgüsé, „Euro 08 City“. Bernerinnen und Berner regen sich nicht so schnell auf, sie neigen eher zur Neutralisierung durch Trockenheit („Dä Cech het öppis Verbotnigs im Heum“), Langsamkeit („wenn spile-mer scho wider?“) und Leidensfähigkeit (YB). Dass ausnahmsweise nicht Bern allein, sondern die ganze Schweiz belächelt wird, ist mir in diesen Tagen recht angenehm. Dass sich SPON über die „örtliche Grammatik“ lustig macht (ja, es heisst hier „der Match“ genau wie „der Dyane“) und über unseren weichspülerischen Umgang mit dem Nationaltrainer witzelt, dass der österreichische Kommentator unsere bergige Eröffnungsfeier im Gegensatz zum eigenen Wiener Walzer phantasielos findet – das passt ganz gut.
Genau wie die Geschichte, die mir meine Coiffeuse (im Bahnhof) heute erzählt hat: Gestern am Nachmittag seien zwei Holländerinnen ins Geschäft marschiert, hätten sich verschiedene Tönungen zeigen lassen und auch noch gefragt, wo das „Public Viewing“ stattfinde? Sie und ihre Kollegin hätten in Hochdeutsch und einfachem Englisch Auskunft gegeben und die Holländerinnen, die nicht bleiben wollten, wieder freundlich verabschiedet. Wenig später sei ein Marketingmensch von Berner Bahnhof und UEFA gekommen und hätte sie informiert, ihre Testergebnisse seien gut, die Umsetzung der Anweisungen aus dem Kurs – den alle Verkäuferinnen und Verkäufer des Berner Bahnhofs absolvieren mussten – im Holländerinnen-Test gelungen. Einzig das „Welcome to Berne!“ zur Begrüssung habe gefehlt. Er erinnere mit Nachdruck daran, dass sämtliche Kunden während der EM so zu grüssen seien.
Wir haben sehr gelacht.
In der heutigen NZZ am Sonntag ist ein schöner Artikel über die Schweiz, die sich – anstatt herauszuragen – exzessiv mit der Perfektionierung des Normalen befasse. Sacha Batthyany bringt darin einige meiner Lieblingsthemen zusammen: Schweizer Stolz auf Understatement, die schweizerische Berufsbildung und ein gutes Buch. Das von Sennett, welches ich bereits an anderer Stelle ans Herz gelegt habe. (Dazu Klammer auf: „Handwerk“ von Sennett ist schlecht zu destillieren. Da es schon vielerorts empfohlen worden ist, ergänze ich nur ein Kaufargument: Hier wird Kitsch entlarvt. Zum Beispiel, Technik sei seelenlos und die Routine der Inspiration unterlegen – der wahre Handwerker suche deshalb Technik und Routine zu vermeiden. Sennett zeigt ein ganz anderes Bild.)
Eigentlich ist der erwähnte Artikel einer über Sanitärinstallateure. Wir brauchen in der Schweiz viele und gute. Für 42’000 km Ableitungskanäle, die Gebäude mit der Kanalisation verbinden, für 47’000 km Abwasserkanäle, die das Abwasser in 759 zentrale Kläranlagen und 3400 Kleinkläranlagen leiten, für ein Kanalisationssystem das doppelt so lang ist wie der Erdumfang, für Abwasserreinigungssysteme in einem Wert von 100 Milliarden Franken – kurz: für die beste Wasser-Infrastruktur der Welt. (Das steht nicht im Artikel, sondern in der Broschüre zum „Interantional Year of Sanitation 2008“). Auch jeden Wasserhahn des Landes mit Trinkwasser zu bedienen und diese Hähne weiter zu entwickeln braucht meisterhafte Sanitärfachleute.
Mein Zitat des Tages:
Was die Schweiz im Fussball nie sein wird, ist sie alle zwei Jahre an den Berufsweltmeisterschaften: der gefürchtete Favorit in allen Sparten. Handwerker der ganzen Welt messen sich in Zeit und Geschicklichkeit, Spengler treten gegeneinander an, Elektriker, Plättlileger, Floristen, Köche.
In diesem Sinne wünsche ich allen weiterhin eine schöne EM.
Und denen, die jetzt ihre Lehre abschliessen, erfolgreiche Prüfungen.