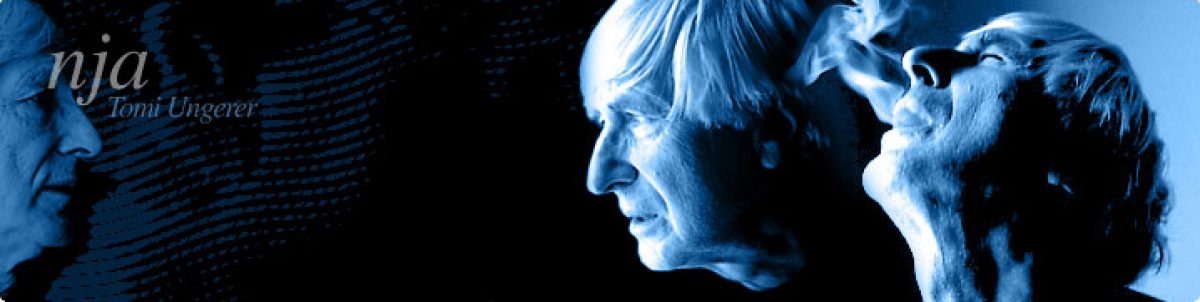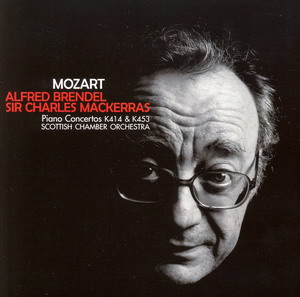Im Westen Berns, wo ich aufgewachsen bin und wohne, gibt es den Plan, ein „Haus der Religionen“ zu schaffen.
Ich war schon an verschiedenen Aktionstagen und Informationsveranstaltungen und habe heute eine kleine Ausstellung in einem Quartierzentrum zum Thema besucht. In diesem auch architektonisch wohl durchdachten „Haus der Religionen“, sollen die bekannten Glaubensrichtungen wie auch religiöse Bräuche von Minderheiten Platz finden.
Die Einteilung ist so vorgesehen:
Die „Spielregeln“ sollen in einem von allen Beteiligten gemeinsam ausgearbeiteten Dokument – der Charta des Hauses – festgehalten werden.
Das politische Echo ist wohlwollend, aber natürlich nicht existenzsichernd. Deshalb bleibt der Plan vorläufig ein solcher und deshalb sucht der Trägerverein Mitglieder.
An der heutigen Ausstellung trat eine langjährige Nachbarin und Betreuerin des Quartier-Tea-Rooms zu mir, um mich nach meiner Meinung zu fragen (übrigens eine Ehre). Ich antwortete, dass es ein sehr ambitiöses Projekt sei. Schön wenn’s gelänge, aber mein Optimismus halte sich in Grenzen. Wir blieben im Gespräch, mein Tee wurde kälter, mein Heimweg auch. Sie erzählte von der Gruppe Afrikaner, die letzten Freitag das Tea-Room zur Schliessungszeit nicht verlassen wollte; von ihrer Hilflosigkeit, als diese ihr Rassismus vorwarfen, als sie eine halbe Stunde nach Ladenschluss keine Sandwichs mehr machen wollte. Das ist kein Einzelfall, das passiert mir häufig, dass „Rassismus“ die Antwort ist, wenn ich Menschen auf Regeln hinweise, ganz egal wie freundlich ich bleibe.
Ich will es nicht verallgemeinern. Doch hier in meinem Umfeld hat der Rassismus von Schweizern und Ausländern hauptsächlich eine Ursache: dass es weder Schulen, noch Quartierzentren, noch Einzelpersonen gelingt, die vorhandenen Regeln durchzusetzen. Wir hätten gute Abmachungen für das Zusammenleben, unsere Gesetze sind transparent und auf demokratischem Wege auch veränderbar. Selbst die alltäglichen Sitten wie Türe aufhalten oder nicht auf den Boden spucken, sind in nützlicher Frist begreifbar. Im privaten Bereich hat man seine Ruhe (finden bekanntlich auch Boris Becker und Michael Schumacher). Die Verletzung der Regeln unseres Zusammenlebens ist hier die fleissigste Zuträgerin für Rassismus.
Und was hat das mit dem „Haus der Relgionen“ zu tun? Neben der Tatsache, dass mir persönlich ein starker Staat immer lieber ist als ein starker Glaube, brauchen wir in diesem Quartier Hilfe und Mittel, die vorhandenen Regeln plausibel zu machen und durchzusetzen.
Kann uns ein „Haus der Religionen“ mit der x-ten Charta auf diesem Erdenrund dabei weiterbringen? Meine Bedenken sind, dass wir – nach zähem Ringen und mit von Kompromissen blutendem Herzen – zwar eine Charta haben werden, aber immer noch nicht den Mut, sie durchzusetzen.
Meine Zuversicht kommt weder von Gott noch vom Verein „Haus der Religionen“, sondern gründet auf dem Ausspruch einer Freundin. Sie möchte ihren Kindern und Nichten eine katholische Heirat sichern und hält die Schweiz für ein schlechtes Terrain:
Du kannst hier nie wissen in diese kleine Land! Was willst du machen als gute Eltern in enge Schweiz? Sie brauchen sich nur einmal umdrehen, schon stehen sie jemand mit andere Glaube gegenüber! Oder mit gar keine!