Heute war ein Ron-Hubbard-Tag. Also einer von den Tagen, an denen ich weiss, dass ich an anderen nur 10% meiner Möglichkeiten ausschöpfe, weil ich darin unterbringe, was ich am Morgen noch als „nicht (in diesem Leben) erledigbar“ deklariert hätte.
An diesem bereits seit Wochen eng verplanten Sonntag kamen noch ein Notfall (mit glücklichem Ausgang) und ein kulinarischer Beitrag zum kommenden Elternabend dazwischen. Und trotzdem habe ich es geschafft, vor High Noon eine uralte Pendenz abzuhaken.
An der Berufsfachschule gibt es so Unglückstopics, die in verschiedensten Fächern und Lehrmitteln auftauchen, aber nirgends so richtig aktuell. Die eigentlich fächerübergreifend unterrichtet werden sollten, aber für die sich dann doch keiner so ganz zuständig fühlt. Zum Beispiel die Mehrwertssteuer, das Urheberrecht oder die Normierung.
The only way out ist in solchen Fällen jemand, der das Thema an sich reisst, ein Dossier für Lernende macht und das auch anderen Topic-betroffenen Lehrpersonen ans Herz legt. Dies munter motiviert und mit dem fröhlichen Input, dass sich alle auf eine Terminologie einigen.
Ich habe nun also den Abend damit verbracht, Unterlagen zu erstellen und eine Bresche für einheitlichen Unterricht zum Thema Nummern und Normen im Buchhandel zu schlagen.
Erfolg ungewiss.
(Jawohl, das ist er. Der kleine Unterschied zwischen Scientology und Schule, zwischen Fundamentalismus und Fundament, zwischen Blindung und Bildung.)
Monat: Februar 2006
Vorurteile
Wenn Frau Tanjas Schönheit gepriesen wird, ist es immer ein Araber.
Als ich den Mann – nach unzähligen Jahren gemeinsamen Weges – fragte, woran das wohl liegen könnte, antwortete er:
Während der gemeine Italiener sich die Frau nackt vorstellte, würde sich der gemeine Araber überlegen, wie sie sich verschleiert machte.
Der gemeine Mitteleuropäer ist kein Mann der grossen Worte, seine Meinung über Italiener, Araber und die eigene Frau bleibt kryptisch.
Sekundärblogging (mal wieder)
Ich muss das zwischendurch, weil ich doch das Medium an sich einfach affentittengeil interessant finde. Heute die Folge „Unterschiede in der deutschsprachigen Blogosphäre“. Ein paradoxes Ansinnen im grenzenlosen Netz. Ich möchte – schweizerisch vorsichtig – warnen: es handelt sich hier um Pauschalurteile.
Vor einigen Wochen (als gerade Jean Remy von Matt als neuer Exportartikel Jo Ackermann in der deutsche Blogosphäre abgelöst hatte), erreichte mich die Frage aus Deutschland, ob die Schweizer Blogosphäre denn wirklich so gesittet sei, wie es den Anschein mache?
Habt Ihr denn überhaupt keine Blogs, wo blinder Islam-Hass verbreitet wird? Wo sich Liberale und Libertäre unflätig beschimpfen? Wo Leute so schreiben wie sie sprechen? Wo 14Jährige Fotos ihrer frisch geritzten Unterarme präsentieren? Wo seitenweise aufgeführt wird, welche Songs man gerade hört oder gleich noch hören wird? Wo genau beschrieben wird, wie man leider, leider eine Unterhaltung des Pöbels in öffentlichen Verkehrsmitteln ertragen musste, weil der Akku des iPods ausgefallen war?
Seither versuche ich darauf zu achten und stelle fest, dass die Unterschiede zwischen den Blogosphären denen ausserhalb jener ähnlich sind: Deutsche sind krasser, aber auch eloquenter. Schweizer formulieren langweiliger, jedoch differenzierter. Die Kommentare in der Schweiz sind distanzierter, weniger persönlich. Auch das kennen die meisten schon aus dem Chat, wenn Deutsche ** knutsch** chatten, chatten Schweizer **?**
Aber die Themen? Die sind doch ziemlich ähnlich, halt so wie der Alltag in dem Teil der Welt, wo sich kaum einer um die unteren Stufen der Bedürfnispyramide zu kümmern braucht. Und wenn doch, dann bloggt der nicht, denn Bloggen ist weiter oben.
Was auf deutsche Leute in schweizer Blogs vielleicht besonders politisch wirkt, gehört für mich eventuell nur in die Kategorie „genervt über“ , und was mich in deutschen Blogs witzig dünkt, klingt für Einheimische bloss abgedroschen. Und vielleicht neigen wir auch einfach dazu, uns gegenseitig besonders internett zu idealisieren.
Was ich in Helvetien gerade gut finde: Dass meistens in Blogkommentaren zum Thema des Eintrags diskutiert wird, dass man kaum Links nachjagen muss, weil jeder gerade selber auch etwas dazu schreibt. So bleiben Themen überschau- und archivierbar.
Was ich für Helvetien gerade überdenkenswert fände: Dass unsere Blogverzeichnisse keine Sex-Blogs (auch nicht die guten Wortblogs) listen.
Was ich in Helvetien gerade blöd finde: Dass es immer noch Journis gibt, die schreiben, Blogger würden nur von Bloggern gelesen.
Aufgeräumte Stimmung
Unsere Familie besteht aus einer Buchhändlerin, einem Buchhändler und einem lesesüchtigen Kind, das alles werden möchte ausser Buchhändler. Selbst wenn wir nur die Bücher behalten, die wir noch nicht gelesen haben oder ein zweites Mal lesen möchten, kommt einiges zusammen.
Immer, wenn es das Portemonnaie oder sonst eine gute Gelegenheit erlauben, verbessern wir unsere Büchergestell-Situation. Ausgangslage sind Billy-Regale oder multifunktionale Errex-Gestelle aus dem Gewerbebedarf. Erstere hängen leider rasch durch, zweitere versprühen einfach den Charme der Metallindustrie.
Dieses Wochenende war das Kind dran. Und weil ich es geschafft habe, die Rapperposter trotz des schmalen Zimmers auf ein Büchergestell-Bild zu bekommen, darf ich auch noch ein paar andere Bilder veröffentlichen. Zwei hier, drei im Kommentar. Und zur neuen Auflage des hier frontal präsentierten „Pinocchio“ hatte die Kaltmamsell ein Einkaufserlebnis.
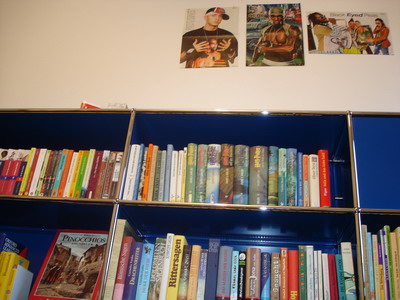

Zur Geschichte der Religion und Philosophie
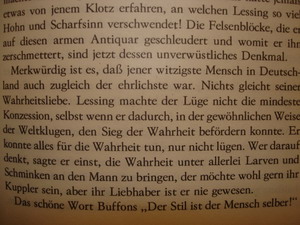
Heine, Heinrich
Zur Geschichte der Religion und Philosophie
In: Heines Werke in fünf Bänden, 5. Band
Bibliothek Deutscher Klassiker
Aufbau Verlag Berlin und Weimar 1986
Auf den ersten Blick scheinen Heines Prosaschriften für historisch, literarisch oder philosophisch nicht speziell gebildete Leute anspruchsvoll. Ich kann nur raten, sie trotzdem zu lesen und garantieren, dass Nichtverstehen einzelner Passagen kein Vergnügen mindert. Schon die Vorrede zur zweiten Auflage „Zur Geschichte der Religion und Philosophie“ lädt ein, Dilemmata mit Sanftmut zu begegnen:
Das vorliegende Buch ist Fragment und soll auch Fragment bleiben. Ehrlich gestanden, es wäre mir lieb, wenn ich das Buch ganz ungedruckt lassen könnte. Es haben sich nämlich seit dem Erscheinen desselben meine Ansichten über manche Dinge, besonders über göttliche Dinge, bedenklich geändert, und manches, was ich behauptete, widerspricht jetzt meiner bessern Überzeugung. Aber der Pfeil gehört nicht mehr dem Schützen, sobald er von der Sehne des Bogens fortfliegt, und das Wort gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe entsprungen und gar durch die Presse vervielfältigt worden.
Ach, was soll ich da ergänzen? Es war typisch für Heine, durch spritzige Prologe und hitzige Briefe die Leserschaft schon vor der eigentlichen Lektüre an sich zu binden. (Ich denke sowieso, Heine wäre heute weder im Journalismus noch in der Politik, sondern im Marketing.)
„Zur Geschichte der Religion und Philosophie“ besteht aus drei Büchern, insgesamt nicht mehr als 130 Seiten. Die drei Teile erschienen zwischen März und Dezember 1834 in der Zeitschrift „Revue des Deux Mondes“ und erst 1935 als Buch bei Hoffmann und Campe in Hamburg. Ich werde pro Buch ein paar Zeilen schreiben, daraus zitieren und von Interpretationen gänzlich lassen.
Im ersten Buch geht es um Luthers enormen Einfluss auf die deutsche Sprache, speziell auch die gebundene Sprache und das Liedgut. Ein Lieblingslied Heines war „Eine feste Burg ist unser Gott“ dessen „begeisternde Kraft“ er oft zu loben wusste.
Selbst Heines Kritik an Luthers Streitschriften ist voller Bewunderung: „plebejische Rohheit, die oft ebenso widerwärtig wie grandios ist.“ Für Heine waren Luthers Originalschriften die wichtigsten Beiträge zur Fixierung der deutschen Sprache. Mit Luther kamen die Persönlichkeit, die Subjektivität, die Reflexion ins Deutsche und das war Heine – dem Teilzeitromantiker – etliche Analysen und Vergleiche wert. Bis er schliesslich konstatieren konnte:
Ich habe gezeigt, wie wir unserem teuren Doktor Martin Luther die Geistesfreiheit verdanken, welche die neuere Literatur zu ihrer Entfaltung bedurfte.
Im zweiten Buch widmet sich Heine der Philosophie und ihrer Transformation vom Lateinischen ins Deutsche. Dabei spielen Christian Wolff (ich kenne ihn leider nicht) und Spinoza und vor allem Lessing zentrale Rollen. Heine weiss immer wieder Persönliches über die granz Grossen zu berichten, zum Beispiel, dass Descartes vom „bewegten, viel schwatzenden“ Frankreich ins „stille, schweigende“ Holland übersiedeln musste. Denn der französische Boden war für vieles gut, aber nicht für das Gedeihen des autonomen philosphischen Gedankens. Die Autonomie der Philosophie war Heine zu diesem Zeitpunkt im französischen Exil ein persönliches Anliegen, weil er bisweilen wünschte, die Religion – und übrigens auch die Schriftstellerei – an den Nagel zu hängen.
Von dem Augenblick an, wo eine Religion bei der Philosophie Hülfe begehrt, ist ihr Untergang unabweichlich. Sie sucht sich zu verteidigen und schwatzt sich immer tiefer ins Verderben hinein. Die Religion, wie jeder Absolutismus, darf sich nicht justifizieren. Prometheus wird an den Felsen gefesselt von der schweigenden Gewalt. Ja, Äschylus lässt die personifizierte Gewalt kein einziges Wort reden. Sie muss stumm sein. Sobald die Religion einen räsonierenden Katechismus drucken lässt, sobald der politische Absolutismus eine offizielle Staatszeitung herausgibt, haben beide ein Ende.
Das dritte Buch handelt hauptsächlich von Kant. Eingangs macht Heine sich lustig über die Kant’sche Disziplin: „Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben. Denn er hatte weder Leben noch Geschichte“. Besonders schön ist, dass Heine – quasi als Ersatz für Kants ereignisloses Dasein – eine Biografie der „Kritik der reinen Vernunft“ entwirft. Wann erschienen, wie lange unbeachtet geblieben, wo dann doch kurz rezensiert und so weiter bis zum durchschlagenden Erfolg.
Damit komme ich zu einem weiteren Aspekt von Heines Prosaschriften und Briefen: sie sind Publikationsgeschichte. Ich habe bis zu Reich-Ranicki nie wieder so umfassende Kenntnis der Verlagserzeugnisse und der Reaktionen darauf gelesen. Das ganz nebenbei. So setzte Heine Meilensteine.
Die deutsche Philosophie ist eine wichtige, das ganze Menschengeschlecht betreffende Angelegenheit, und erst die spätesten Enkel werden darüber entscheiden können, ob wir dafür zu tadeln oder zu loben sind, dass wir erst unsere Philosophie und hernach unsere Revolution ausarbeiteten. Mich dünkt, ein methodisches Volk wie wir musste mit der Reformation beginnen, konnte erst hierauf sich mit der Philosophie beschäftigen und durfte nur nach deren Vollendung zur politischen Revolution übergehen. Diese Ordnung finde ich ganz vernünftig. Die Köpfe, welche die Philosophie zu Nachdenken benutzt hat, kann die Revolution nachher zu beliebigen Zwecken abschlagen. Die Philosophie hätte aber nimmermehr die Köpfe gebrauchen können, die von der Revolution, wenn diese ihr vorherging, abgeschlagen worden wären.
zum Dritten.
Um uns über die Qualität unseres Unterrichts klar zu werden, besuchen wir einander. Wie für vieles haben wir Lehrpersonen auch dafür ein bescheuertes Wort, nämlich „Tandem“ (alternativ: „kollegiale Hospitation“). Ich und meine Kollegin machen das gern, weil es wirklich nützt.
Ergänzend zu der Beurteilung, die wir einander abgeben, lassen wir uns je gegenseitig auch von den Lernenden beurteilen, welche ihr Urteil mit Namen unterzeichnen und Gelegenheit für Verbesserungsvorschläge haben. Wir sehen aber nur die Fragebogen, die für die andere ausgefüllt wurden, und auch die Auswertung und die Analyse machen wir je gegenseitig.
Befragt werden immer die Klassen des Abschlussjahrganges, die unseren Unterricht gut kennen. Die offizielle Unterrichtsbefragung der gesamten Schule (nach ISO, jeder wird mindestens von einer Klasse beurteilt) ist nach Lehrjahren gemischt. Es kann einen da also gut mit einer Klasse treffen, die erst sieben trockene Stunden bei einem hatte.
Lehrerinnen und Lehrer werden bekanntlich kaum gelobt. Deshalb ist es natürlich schön, in den Umfragen gut abzuschneiden. „Alles im dunkelgrünen Bereich“ meint die Kollegin dieses Jahr zu meinem Unterricht. Ihre Ausführungen sind mir zu persönlich für hier, aber die Ergebnisse der Umfrage habe ich schon letzes Jahr publiziert. So können sie auch die Azubis jederzeit anschauen. (Wobei das ja nur eine Mutprobe ist, wenn die Ergebnisse schlecht sind.)
Ergebnisse 2006.
Ergebnisse 2005.
zum Zweiten,
Während ich Das Methusalem-Komplott (schon vor den obligaten 50 Seiten, die ich einem Buch sonst gebe,) entnervt zugeklappt habe, fand ich Schirrmachers Replik auf Botho Strauss‘ Essay im aktuellen SPIEGEL äusserst passend. Sie deckt sich nicht nur mit meinen Ansichten von heute Abend, sondern auch mit meinen Erfahrungen.
Meine Einstellung wird vor allem in meiner plolitischen (Hintergrund-) Arbeit als „realitätsfremd“ weil wir ja „keine Propheten“ seien, quittiert. Aber vielleicht ändern sich ja die Zeiten?
Und weil Blog Lesende ja nicht zwangsläufig auch Gedanken Lesende sind, hier die Einstellung, die ich meine:
Was Integration (oder Aids-Prävention) kostet, interessiert mich nicht. Ich will wissen, was es kostet, wenn wir es nicht tun. Nach fünfzehn Jahren Sparmassnahmen brauche ich keine Prophetin zu sein, um karikiert zu werden eine grobe Kostenrechnung zu machen. Und zu merken, dass wir mit „von uns verantwortungslos schlecht ausgebildeten Zuwanderer[n]“ (Zitat Schirrmacher) mehr zu verlieren haben als Geld.
Klarheit zum Ersten,
Bildung von Kindern ist wie Luft. Unmöglich ihren Anfang und ihr Ende zu bestimmen, sie atmen sie immer und überall. Wir müssen die Bildung hier und jetzt gemeinsam klar und gesund behalten. Denn wir haben ein Ziel: Dass sich die Kinder in ihrem Umfeld sicher bewegen und gut entwickeln, dass sie als Erwachsene einen passenden Beruf finden und unabhängig leben können. Sippschaften, Ressentiments und die Träume der Eltern haben nicht Prioriät. Denn dass die Kinder unsere Welt bekommen werden, ist eine Tatsache. Es ist in unserem Interesse, dass sie sicheren Boden unter den Füssen haben und nicht völlig zerrissen sind, wenn sie dereinst das Ruder übernehmen.
Wer sich für die „Tamilische Schule“ interessiert hat, will vielleicht auch den ausführlichen Kommentar einer Vertreterin dieser Schule lesen. Das oben ist ein Auszug aus meiner Antwort, die quasi automatisch für mich zentrale Gedanken zur Integration integriert hat.
Tischgespräch [8]
Mutter:
Kind, hast du dich jetzt entschieden, was du dem Mädchen antwortest, das dich liebt?
Kind:
Nö- ö.
Mutter:
Hmm. Nun sind aber doch die vereinbarten 14 Tage Bedenkzeit um? Hat sie so viel Geduld?
Kind:
Sie tut schon während der 14 Tage so, als ob ich mit ihr gehen würde, ohne meine Antwort abzuwarten. Dauert eh höchstens noch eine Woche, dass sie mich liebt.
Vater:
Wie kannst du da so sicher sein?
Kind:
Dank ein wenig mathematischem Geschick. Sie hatte neun Freunde [zählt alle neun Namen an den Fingern ab] in einem halben Jahr. Das macht knappe drei Wochen pro Freund.
Mutter:
Würdest du dir denn wünschen, dass sie dich noch länger liebte?
Kind:
Also… ja. Es ist immer gut, wenn man eine hat, die einen liebt. Es ist wie mehr Geld auf deinem Konto als du verdient hast, ein zusätzliches Guthaben halt.
Rückfutter
Am Karikaturenstreit-Drehbuch soll ich nicht mehr mitschreiben, meint die Familie.
Mann:
Ich krieg Beulen, wenn ich noch einmal etwas zu dem Thema ertragen muss, wozu hab ich denn keinen TV!
Kind:
Viele suchen einfach irgend einen guten Grund zu kämpfen, ist doch gaga. Aber das haben die Ritter ja auch immer gemacht, sonst fühlten sie sich nicht nützlich.
Meine Mutter:
Reine Männer-Selbstdarstellung. Am Ende werden sie noch den Angriff auf den Iran mit diesem Affentheater rechtfertigen. Ich kann es nicht mehr hören!
Meine Schwester:
(seufzt enerviert)
Mein (muslimischer) Schwager:
Ich bin nicht beleidigt, danke.
Und es gibt noch andere, die die Ruhe weg haben. Wie Asad Suleman, der über Fallgruben hüpft oder Salman Rushdie, der im Glück die Heimat findet.
Dank Blog-Abstinenz habe ich nun meine Zeitungslektüre aufgearbeitet. Und die Familie hat schon Recht, es wird Zeit, dass ich mich wieder anderem zuwende als dem Kulturkampf. Auch wenn er mir in seiner Unsachlichkeit, die Gewalt eigen ist, grosse Sorgen bereitet.
Jetzt suche ich erst einmal meine Notizen zum Tischgespräch über die Liebe.
