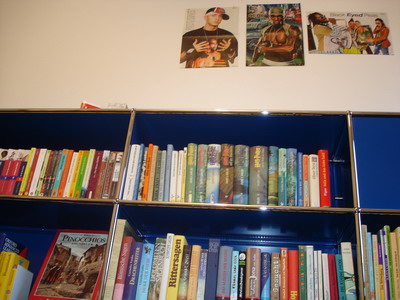Das Schöne an der Rütli-Schule-Diskussion ist, dass ich dazu gar nichts zu sagen brauche, weil ich es entweder schon gesagt habe, ein anderes Blog es schon gesagt hat oder eine Zeitung es gleich sagen wird. Ich habe mich das vergangene Jahrzehnt oft verteidigen müssen, aber im Moment bin ich echt bei den Leuten. Nachdem sich die NZZ am (letzten) Sonntag noch entblödet hat „Der Multikulti-Mythos wankt“ zu titeln, vermeldet heute sogar SPON mein Credo: Multikulti ist nicht erfolgreich oder gescheitert, sondern Realität. Die ZEIT hatte es schon viel früher gemerkt.
Das Tragische an der Rütli-Schule-Diskussion ist, dass sie nichts ändern wird. Dass sich damit kein einziger tropfender Wasserhahn flicken lässt und kein noch so kleiner Band-Raum daraus entstehen kann. Eher wird einer geschlossen („Ende der Kuschelpädagogik“).
Und ich korrigiere Test Nr. 1-13 zum Thema Zwischenbuchhandel, Kreditoren und Mehrwertssteuer.
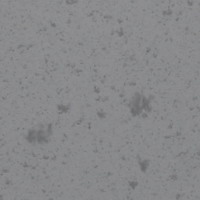
Zwischen Amüsement und Verbitterung schwanke ich, wenn sich hinter jeder neuen Integrationskrise ein sozialdemokratischer Bürgermeister aus der Schale pellt, der eigentlich schon lange gewarnt hat. Nun, Heinz Buschkowksy (Neukölln, D), Dilain Claude (Clichy-sous-Bois, F) und Boris Banga (Grenchen, CH) werden bald nicht mehr allein, sondern an der Spitze einer langen Polonaise durch die überhitzten und auf Hirsebrei heruntergesparten Küchen Europas wanken.
Und ich korrigiere Test Nr. 14 – 20 noch immer zum gleichen Thema. Und einen Nachholtest zu Nummern und Normen.
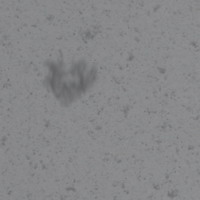
Von mir aus kann man gerne sämtliche individuelle, nicht für den Unterricht verwendete Elektronik auf dem Schulareal verbieten, Handys und iPods können mir da wirklich gestohlen bleiben. Aber die Sanktionen und deren Umsetzung müssten pro Schule klar sein. Alternativen müssten auf- und ausgebaut werden. Kurzfristig hiesse das: Räume für das Abspielen guter Filme. Mittelfristig: Permanente Schulsozialarbeit mit dem ganzen Friedensstifter-Programm, Pausenbetreuung inklusive gesunde Ernährung und zielorientierten Medienkonsum, an dem alle teilhaben können, die wollen. Langfristig: Mediotheken mit Büchern, Lernspielen und einer freundlich-bestimmten hübschen Dame à la Mary Poppins am Desk. Ja, ich weiss, dass das unrealistischer ist als das Leben auf dem Mars.
Und ich korrigiere und layoute 16 Prüfungsfragen eines Kollegen zum Thema Warenkunde.

Beim Bündeln des Altpapiers begegnen mir noch einmal die Fragen an Einbürgerungswillige, die die NZZ am Sonntag aus verschiedenen europäischen Ländern gesammelt hat (nicht online). Sie scheinen mir furchtbar kompliziert. Ich würde lieber mündlich und mehr auf unsere Verfassung bezogen fragen, denn hier liegt mein häufigstes Integrier-Problem. Man unterhält sich über alles, nur nicht darüber, wie etwas hier gesetzlich geregelt ist. Jede Frau darf ein Kopftuch tragen, wenn sie nicht irgend eine andere Uniformpflicht oder Hausordnung unterschrieben hat, aber niemand hat das Recht, sie dazu zu nötigen.
Ich weiss ja selber nicht, was kluge Fragen wären. Gut Integrierte sollten sie ja wirklich einfach beantworten können, sonst wird es absurdes Theater.
Ich korrigiere dann mal den Plan der Lehrabschlussprüfung und ergänze die Schulwebsite um die Daten.

Vielleicht würde ich fragen:
Sicher ist es wichtig, dass Einbürgerungswillige wissen, dass Homosexualität bei uns nicht strafbar und für die meisten viele ganz gewöhnlich ist. Aber für mich ist die Akzeptanz von Homosexualität unter anderem eine Folge davon, dass wir hier unsere Kinder weder zusammenschlagen noch enterben noch zur Reproduktion mit einem von uns gewählten Partner zwingen dürfen.
Und jetzt korrigiere ich Test 1-10 zum Thema „ökologische, technologische, soziale und ökonomische Einflüsse auf Ihr Unternehmen“. Und dann ist es genug.